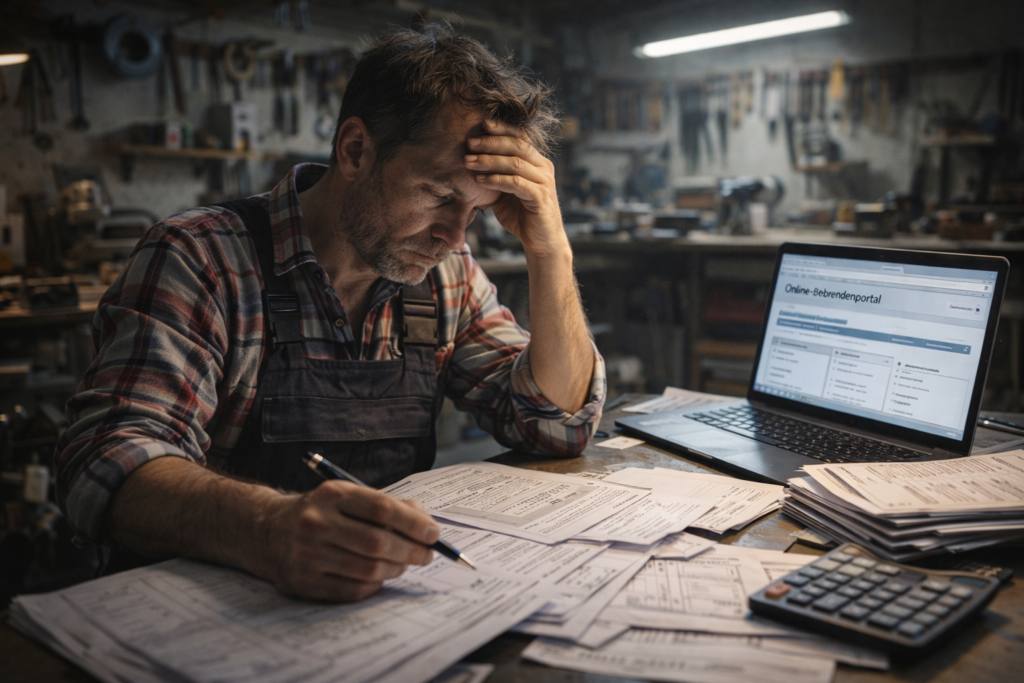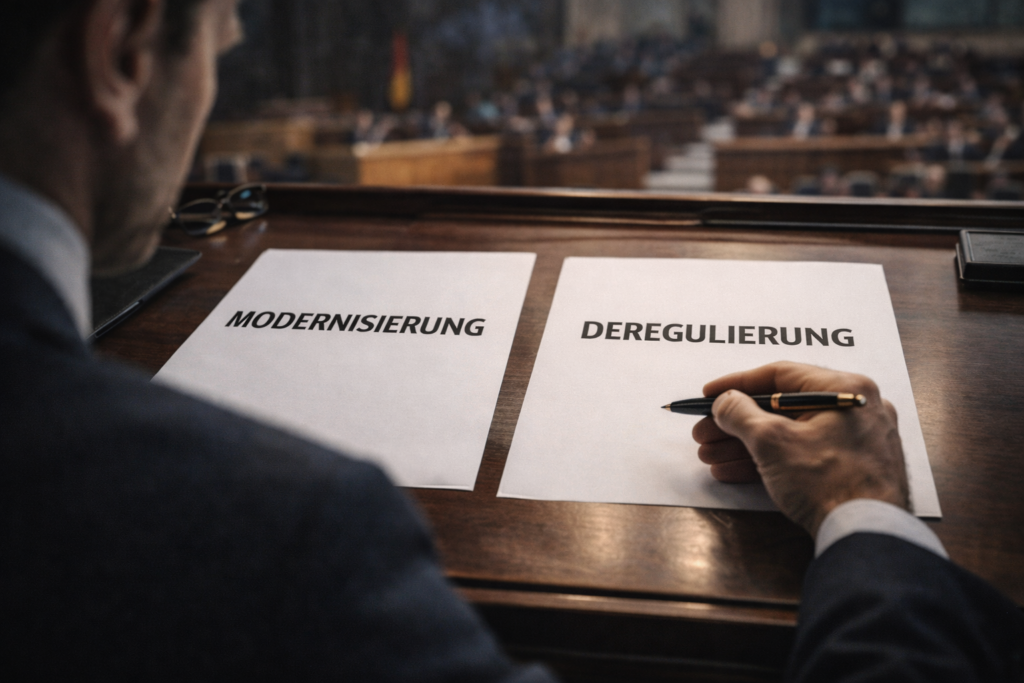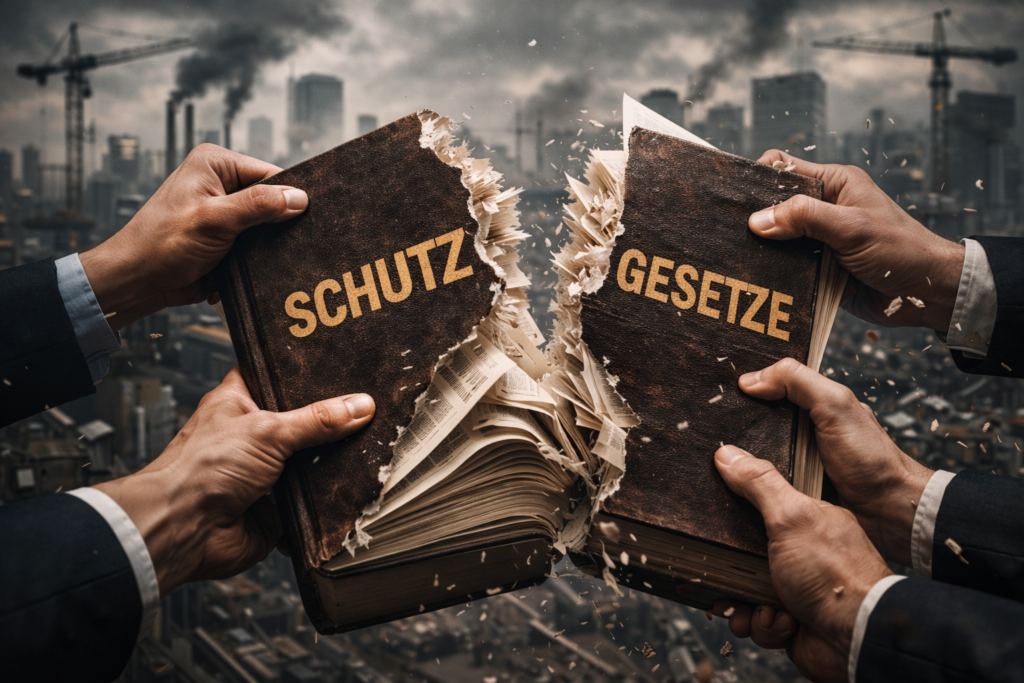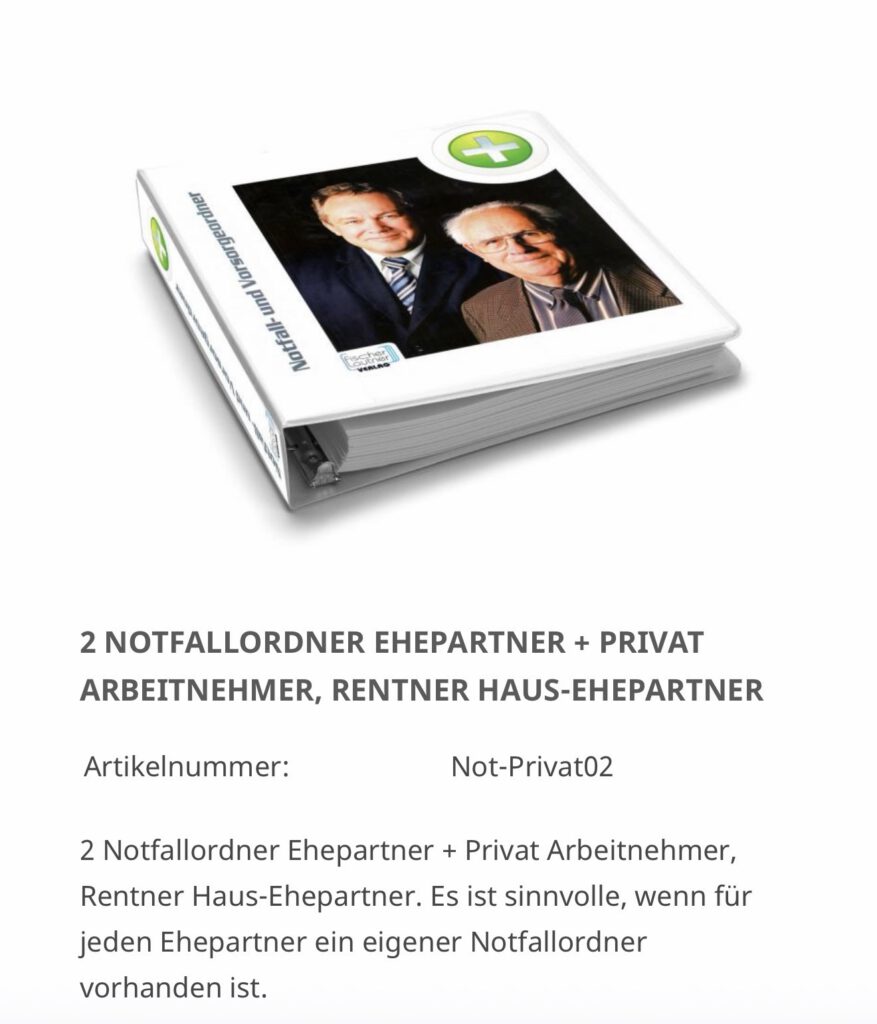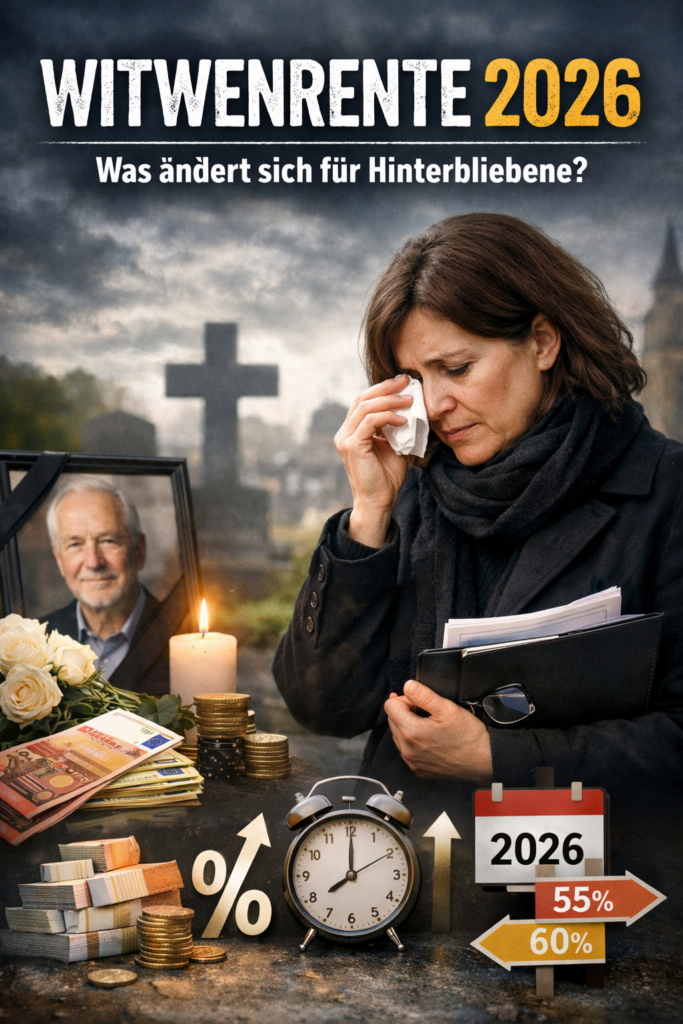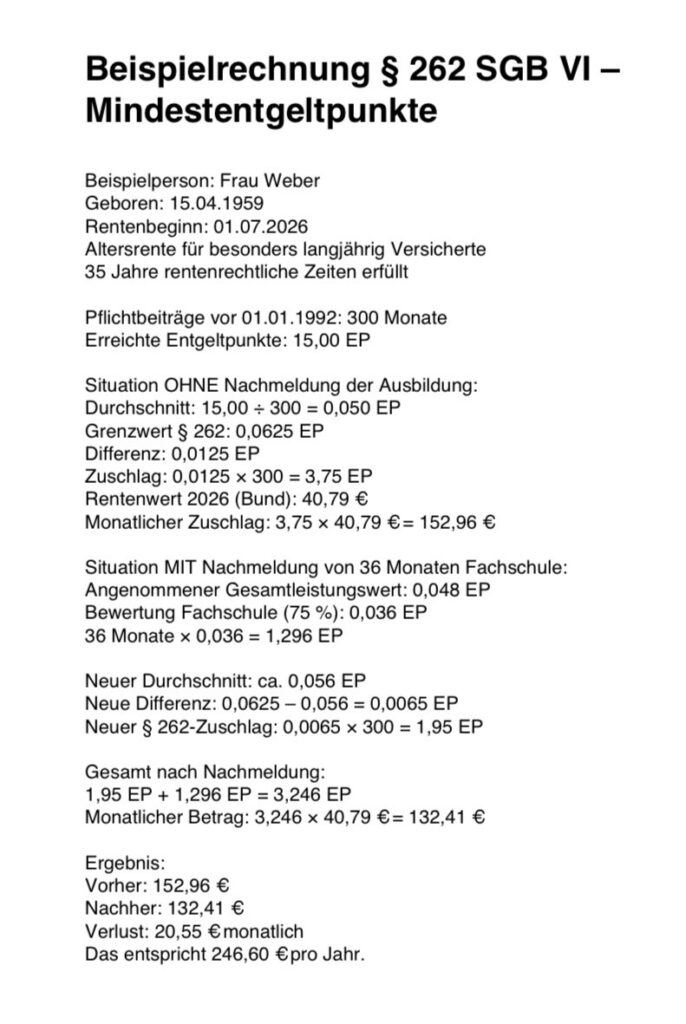Ein Beitrag von

Werner Hoffmann
Keine Frage: Der Iran ist ein Staat, der Opposition unterdrückt, Frauenrechte massiv einschränkt und grundlegende Freiheitsrechte verletzt. Doch Außenpolitik folgt selten ausschließlich moralischen Motiven.
Donald Trump mischt sich kaum wegen Menschenrechten ein. Sein Interesse dürfte vor allem wirtschaftlicher Natur sein: seltene Erden, strategische Rohstoffe, Öl und Gas. Auch sein Umfeld – etwa Jared Kushner – könnte wirtschaftliche Chancen in einer geopolitischen Neuordnung sehen.

Der Iran gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt.
Die wichtigsten Rohstoffe im Überblick
- Energie: Erdöl (ca. 12 % der Weltreserven), Erdgas (15–17 % der globalen Reserven)
- Metalle: Kupfer, Eisenerz, Zink, Blei, Chrom, Mangan, Silber
- Strategische Rohstoffe: Potenzielle seltene Erden, Lithium-Vorkommen, Strontium

Seltene Erden sind essenziell für Batterien, Rüstungstechnologie, Halbleiter und erneuerbare Energien. Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt ist hoch. Wer alternative Fördergebiete kontrolliert, gewinnt strategische Macht.
Hinzu kommt die Straße von Hormus – jede Eskalation dort beeinflusst sofort die globalen Energiepreise.

Die entscheidende Frage lautet daher: Geht es wirklich um Sicherheit – oder um wirtschaftliche Einflusszonen und Ressourcen?
Geschichte zeigt, dass geopolitische Interventionen selten ohne ökonomische Interessen stattfinden.

Wer die aktuelle Lage bewertet, sollte daher neben der Kritik am iranischen Regime auch wirtschaftliche Motive der Gegenseite analysieren. Machtpolitik und Ressourcen sind historisch eng miteinander verknüpft.
#Iran #Rohstoffe #SelteneErden #Geopolitik #Energiepolitik