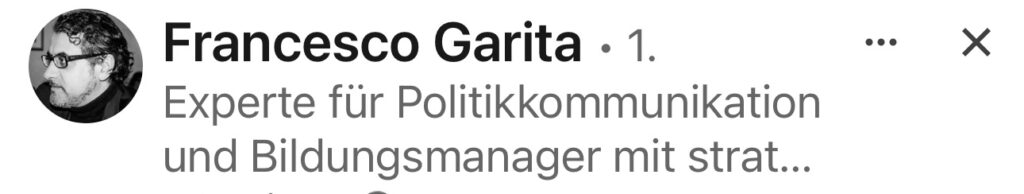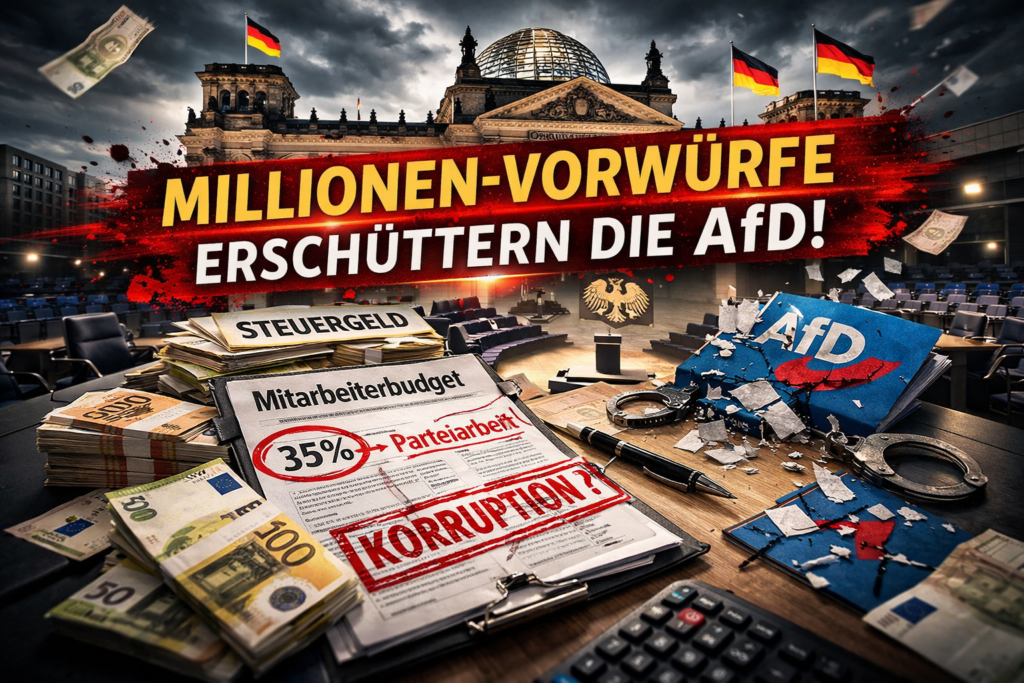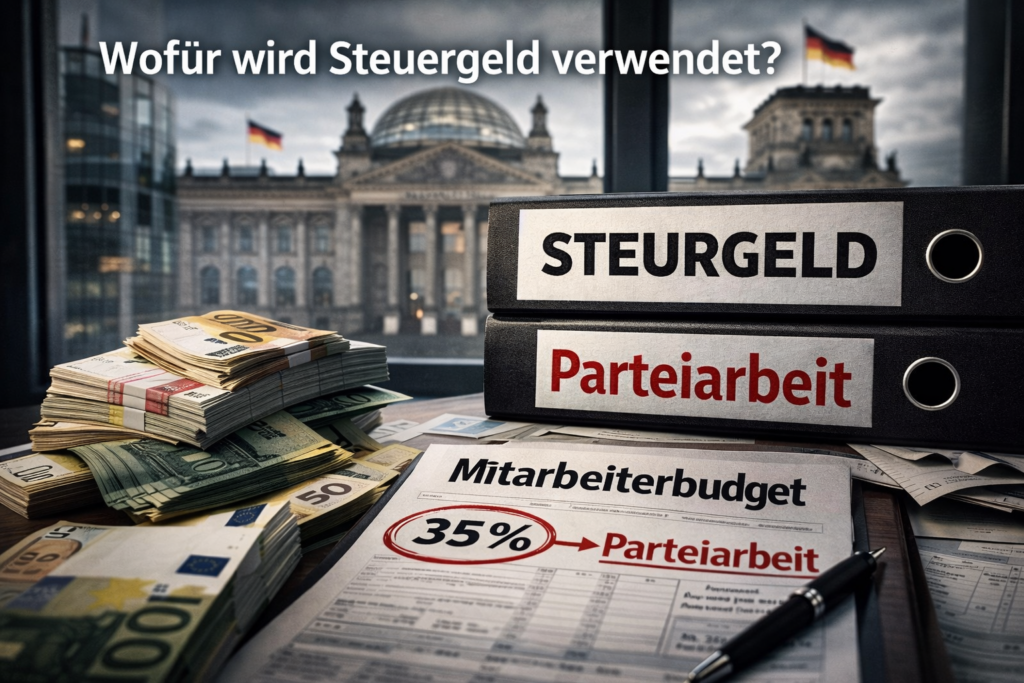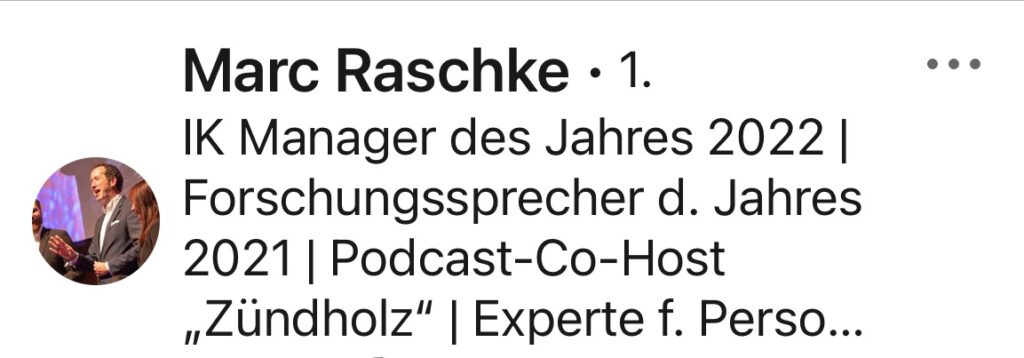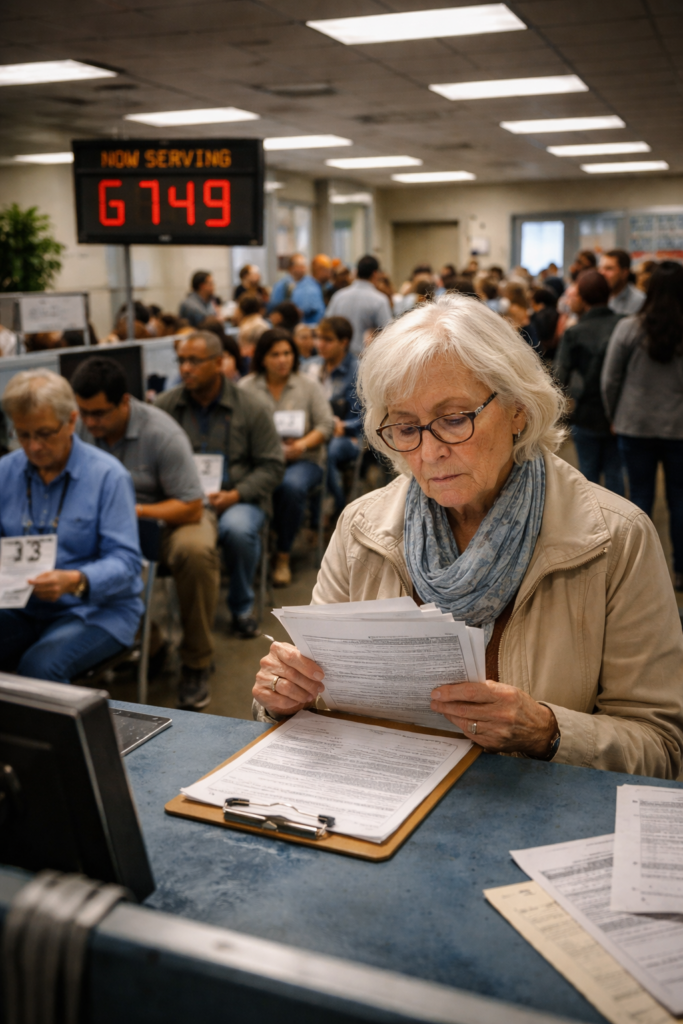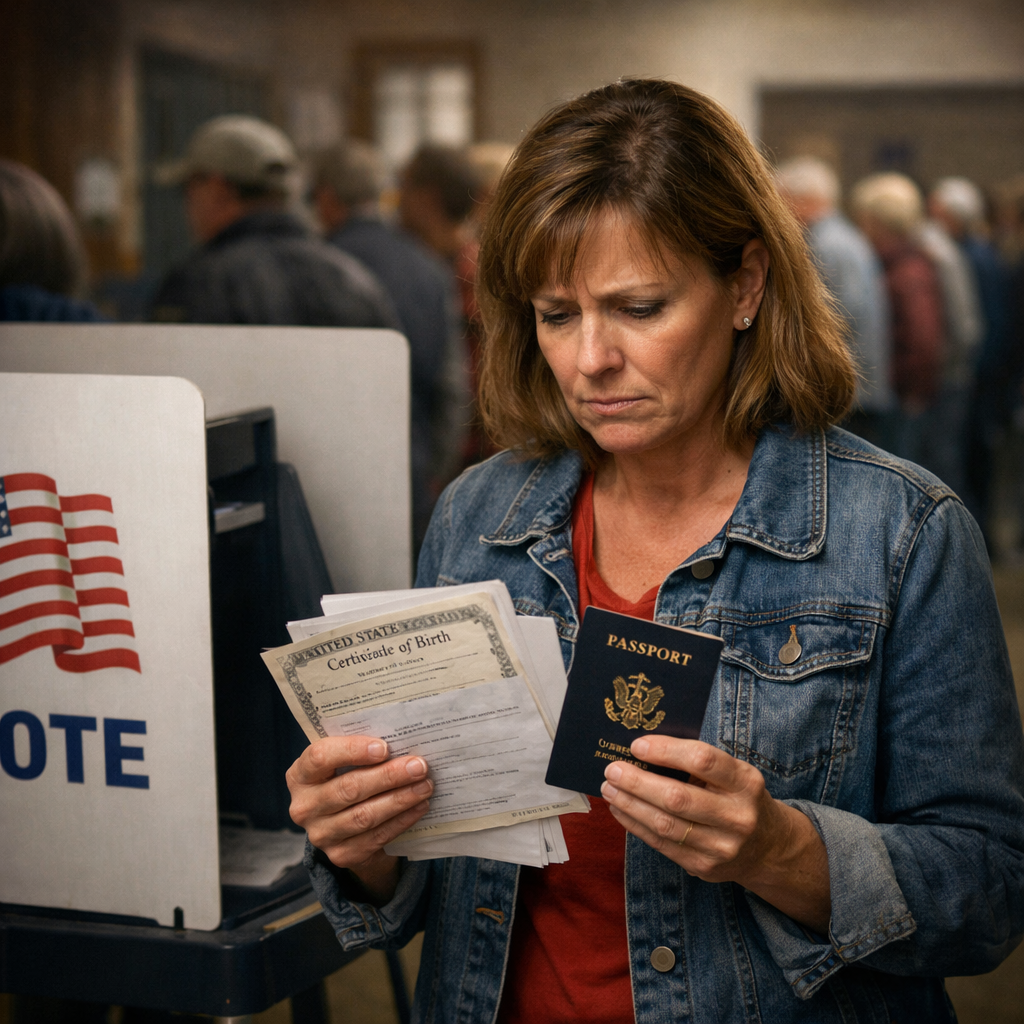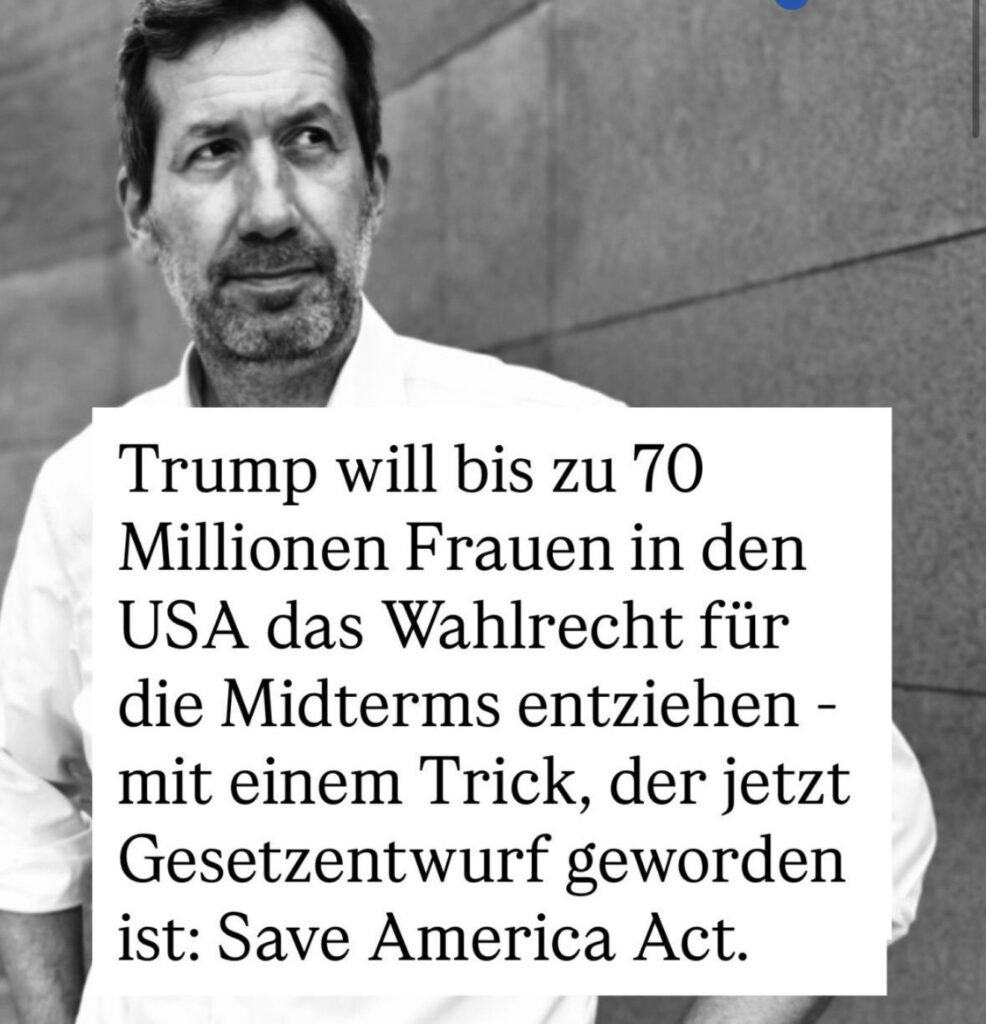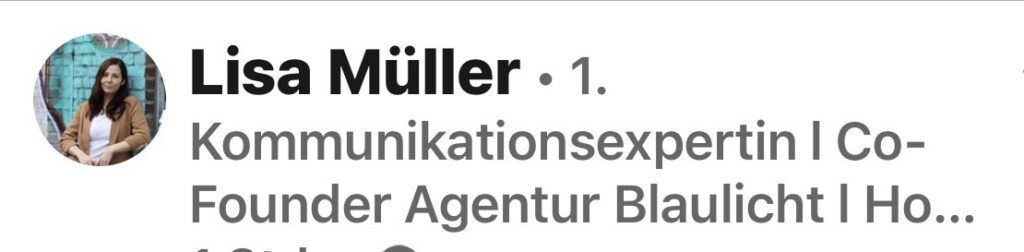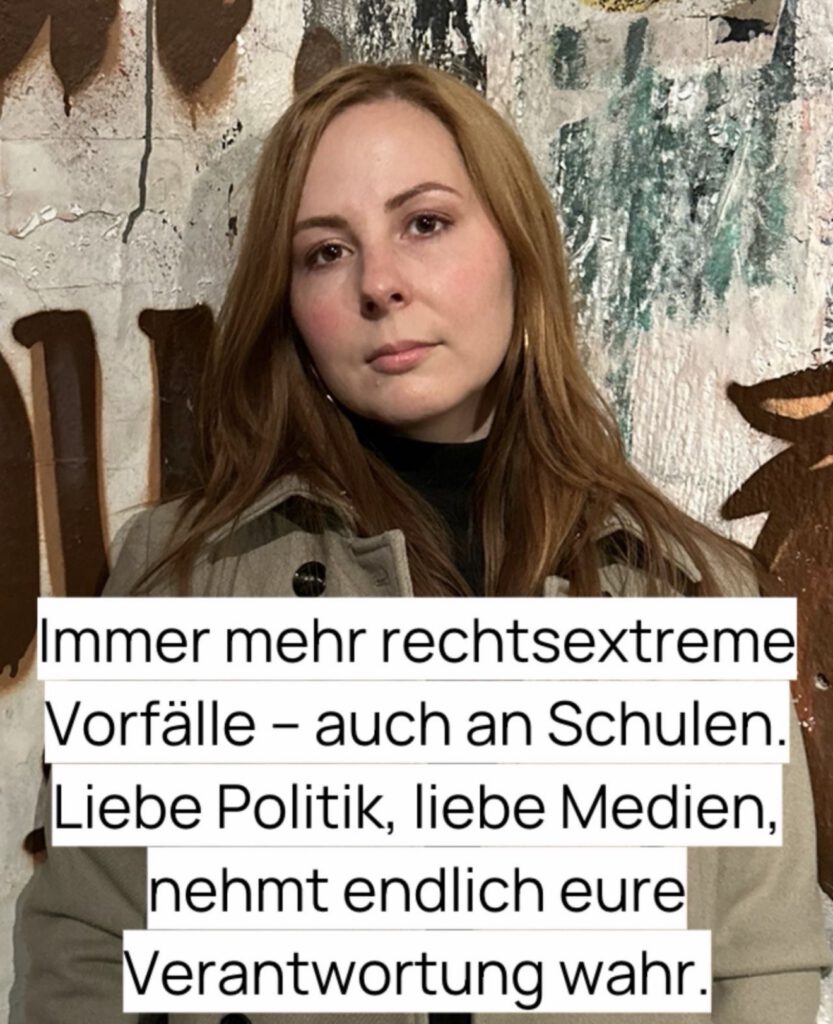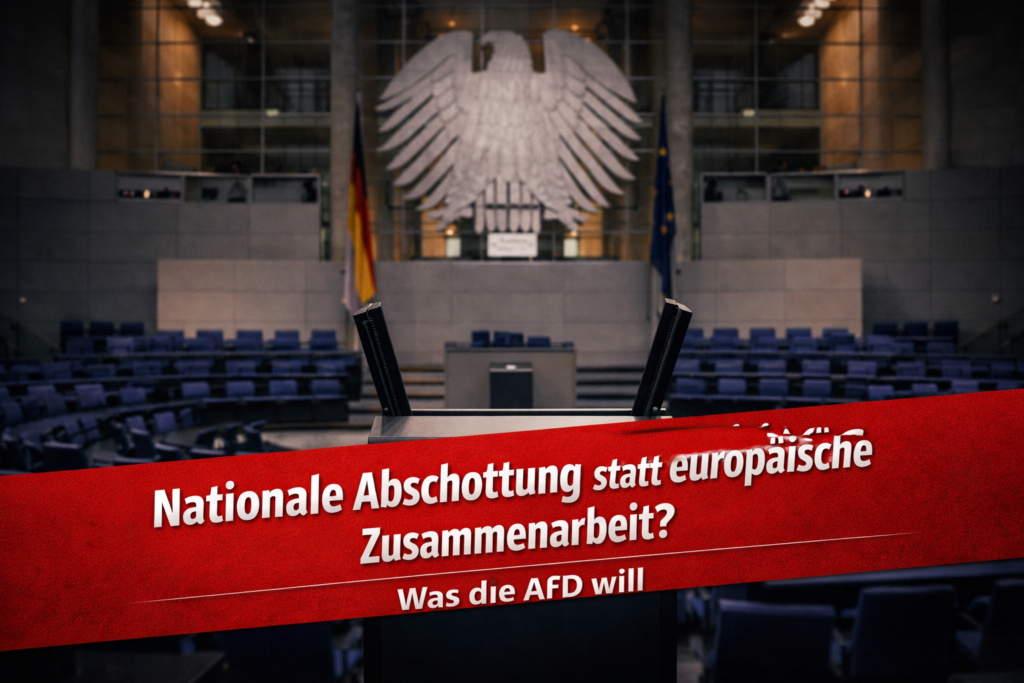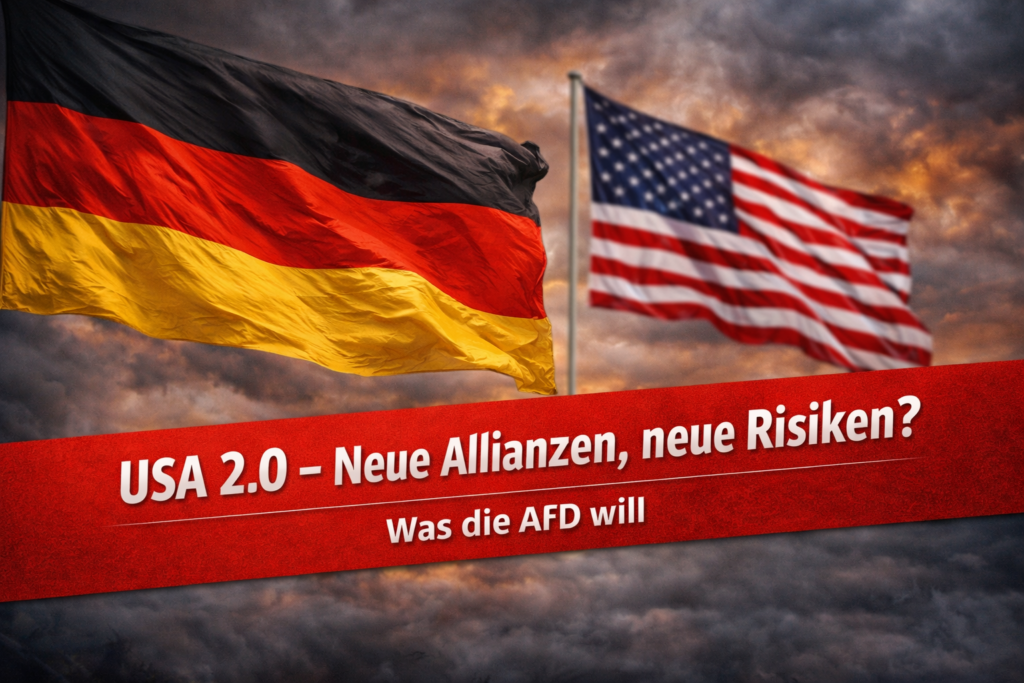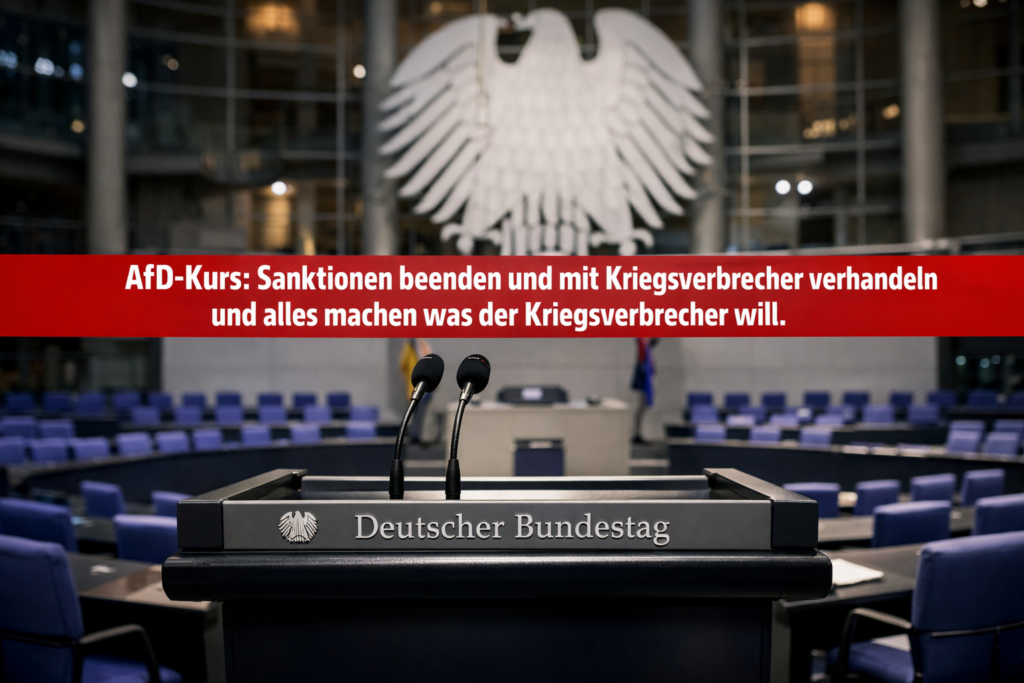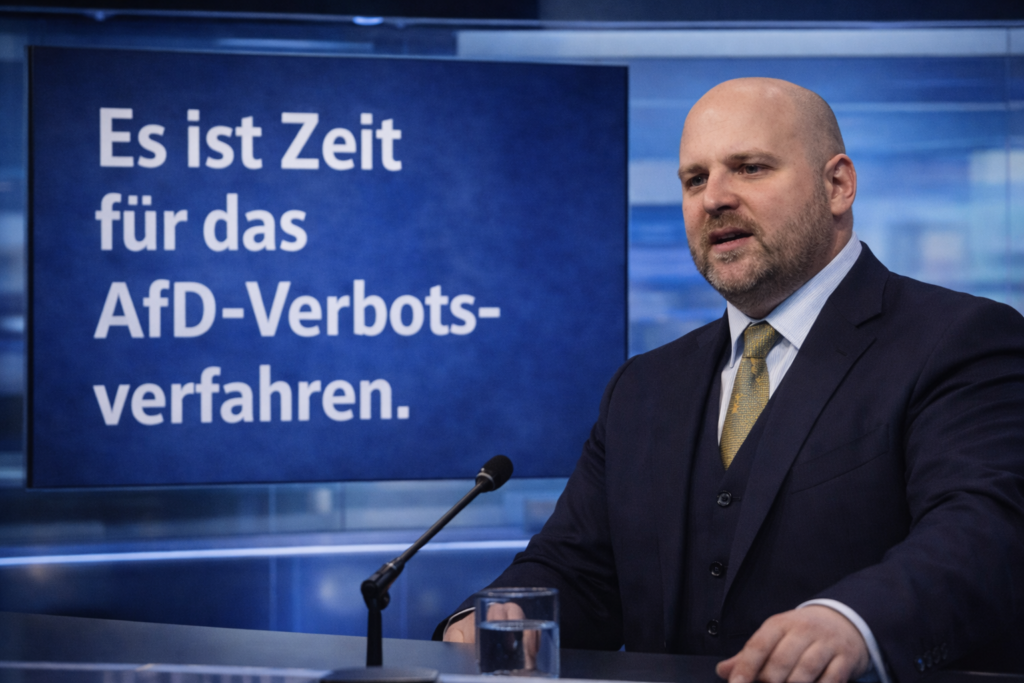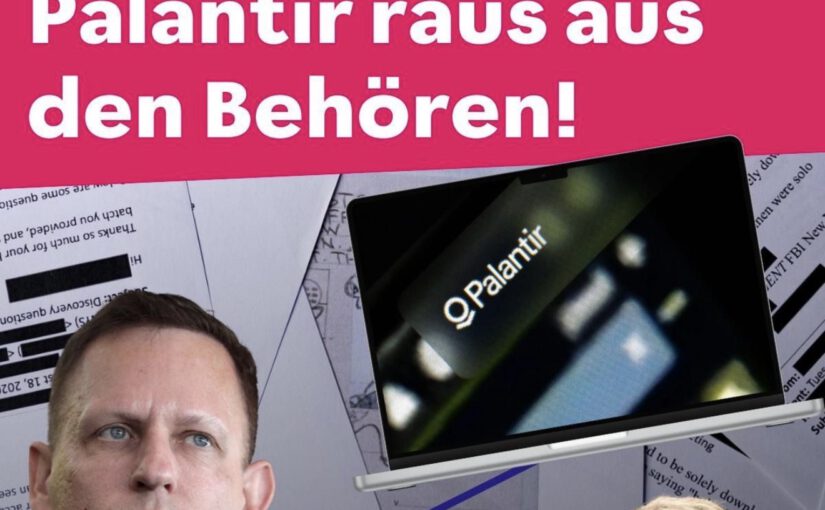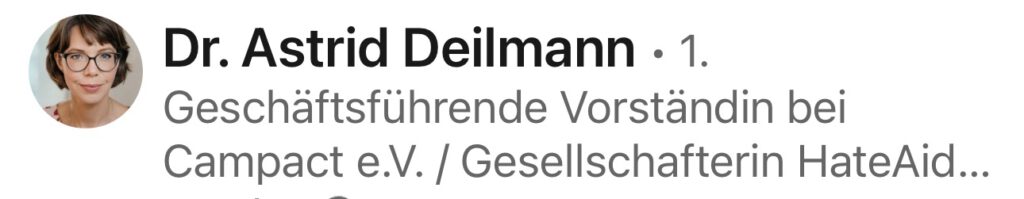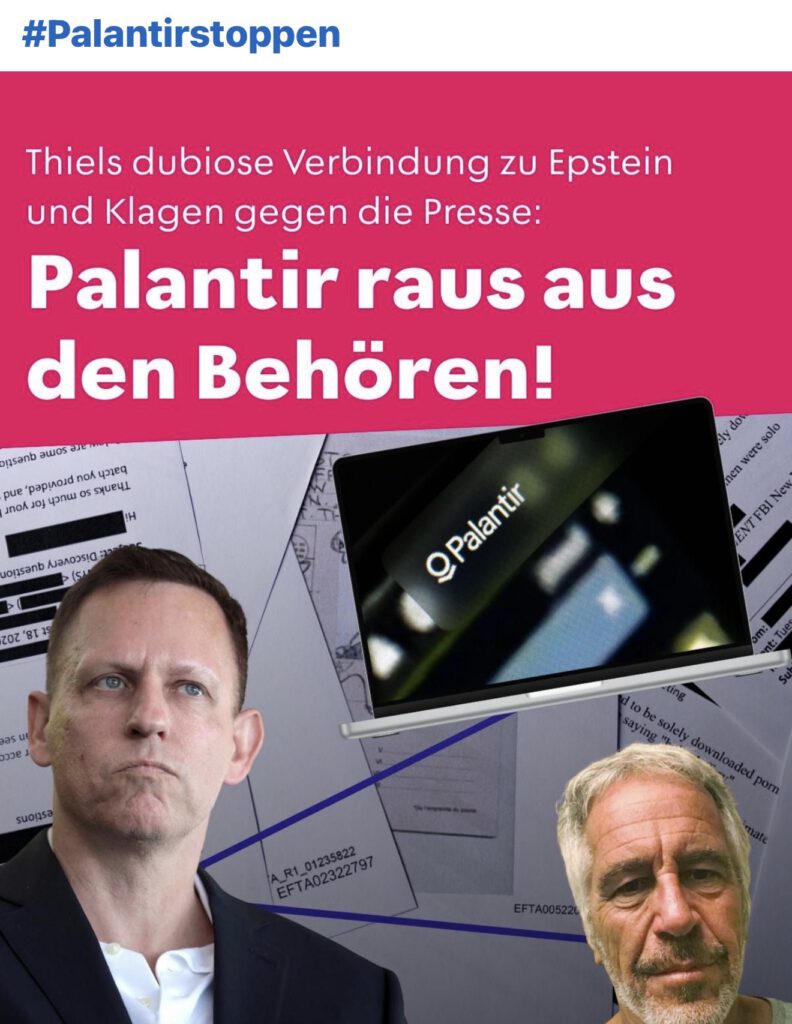Ein Beitrag von

Werner Hoffmann
Überzeugter, demokratischer Europäer
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat zentrale Teile der von Donald Trump verhängten Strafzölle für unrechtmäßig erklärt. Mit deutlicher Mehrheit stellten die Richter klar: Der Präsident hat seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschritten.
Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 berufen – den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Dieses Gesetz erlaubt wirtschaftliche Maßnahmen bei außergewöhnlichen nationalen Bedrohungen. Doch Zölle werden darin nicht ausdrücklich genannt. Genau hier setzte das Gericht an: Die Kompetenz zur Erhebung von Zöllen liegt laut Verfassung beim Kongress – nicht beim Präsidenten.

Trump hatte Handelsdefizite und den Schmuggel von Fentanyl als Begründung für einen wirtschaftlichen Notstand angeführt. Auf dieser Grundlage verhängte er Strafzölle gegen mehrere Staaten. Mehrere Unternehmen sowie demokratisch regierte Bundesstaaten klagten dagegen. Nun hat das höchste Gericht entschieden: Diese Konstruktion trägt rechtlich nicht.
Was bedeutet das für bereits gezahlte Zölle?
Sollte das Urteil endgültig Bestand haben, könnten betroffene Unternehmen Rückerstattungen verlangen. Das würde Milliardenbeträge betreffen und den US-Haushalt erheblich belasten. Für Importeure wäre es eine spürbare Entlastung – für die Staatskasse ein finanzieller Rückschlag.

Welche Wirkung hat das auf Trump und seine Administration?
Politisch ist das Urteil ein empfindlicher Dämpfer. Ein zentrales Instrument seiner Handelspolitik wurde gestoppt. Gleichzeitig stärkt die Entscheidung die Gewaltenteilung in den USA. Der Supreme Court macht deutlich: Auch ein Präsident kann seine Kompetenzen nicht unbegrenzt ausdehnen.

Für Unternehmen und Märkte bedeutet das zunächst Unsicherheit. Internationale Partner beobachten genau, wie verlässlich die US-Handelspolitik künftig gestaltet wird. Die Entscheidung sendet ein klares Signal: Rechtsstaatlichkeit steht über politischer Taktik.

Resümee:
Das Urteil ist mehr als eine juristische Korrektur. Es ist ein Prüfstein für die amerikanische Demokratie. Sollten milliardenschwere Rückzahlungen folgen, wäre das nicht nur ein finanzieller, sondern auch ein politischer Rückschlag für Trumps Administration.
Problem ist nur:
Was passiert, wenn Trump das Urteil ignoriert?
Der Oberste Gerichtshof hat keine Handhabe in Form eine Executiven für die Durchsetzung des Urteils.
Damit wäre aber dankbar, dass die Trump-Administration ein Diktatur ist.

#Trump #SupremeCourt #USZölle #Rechtsstaat #Handelspolitik