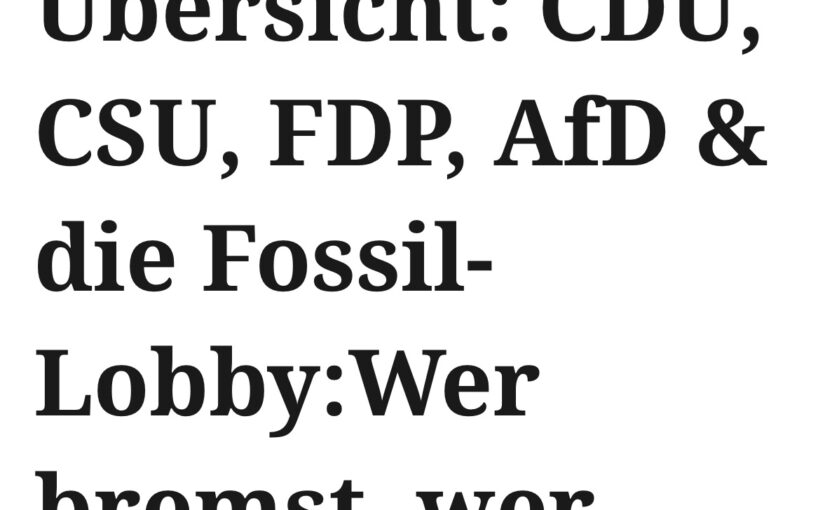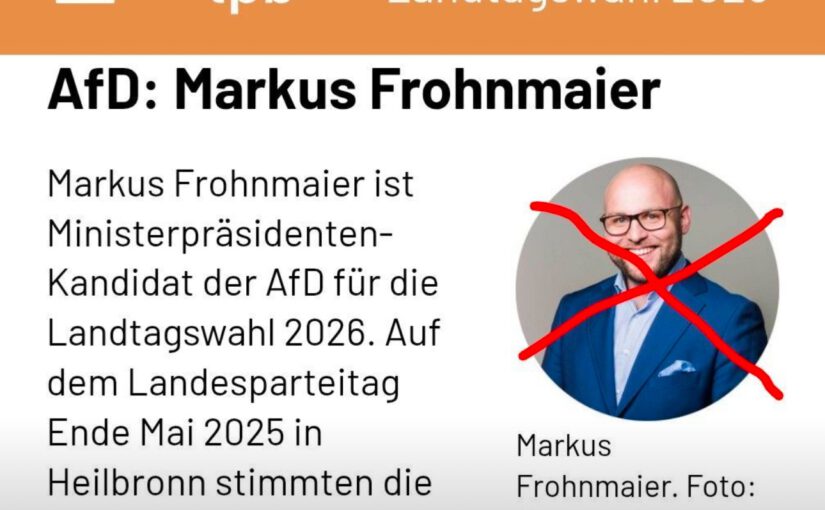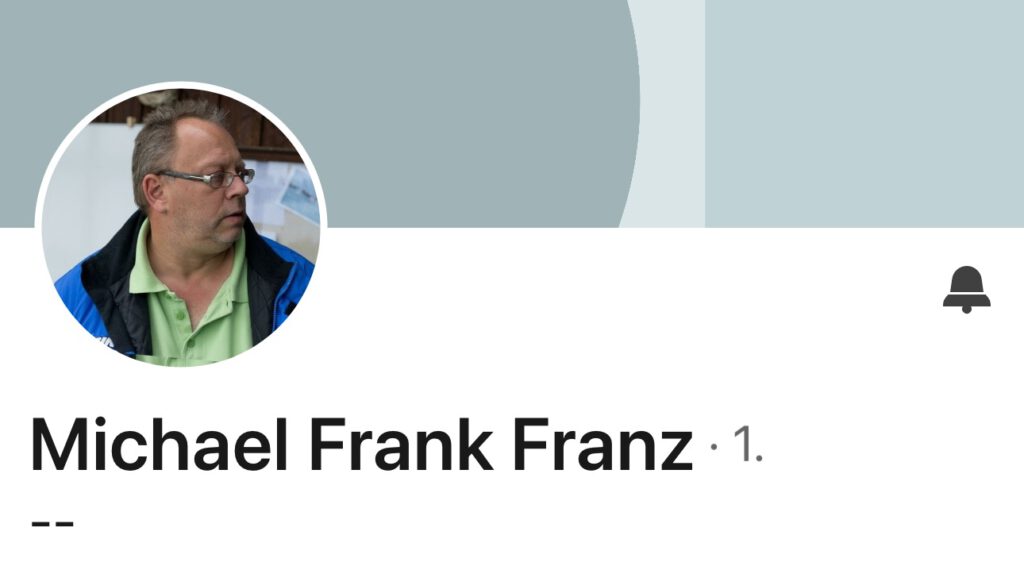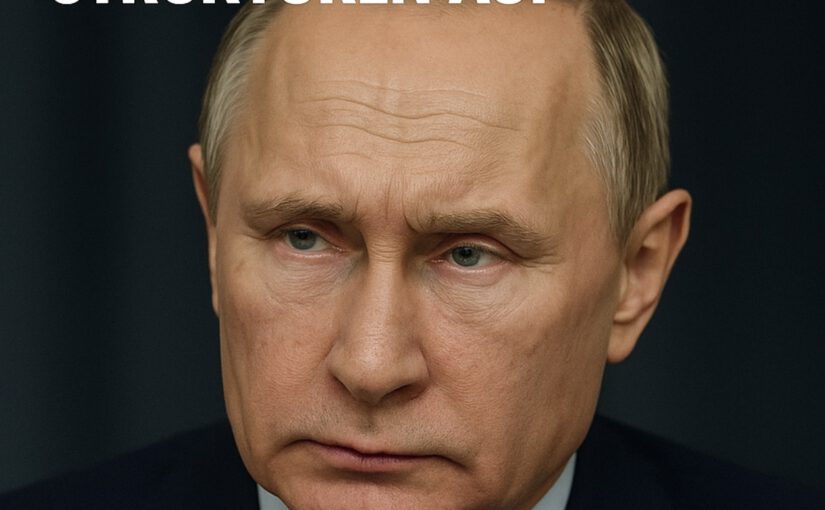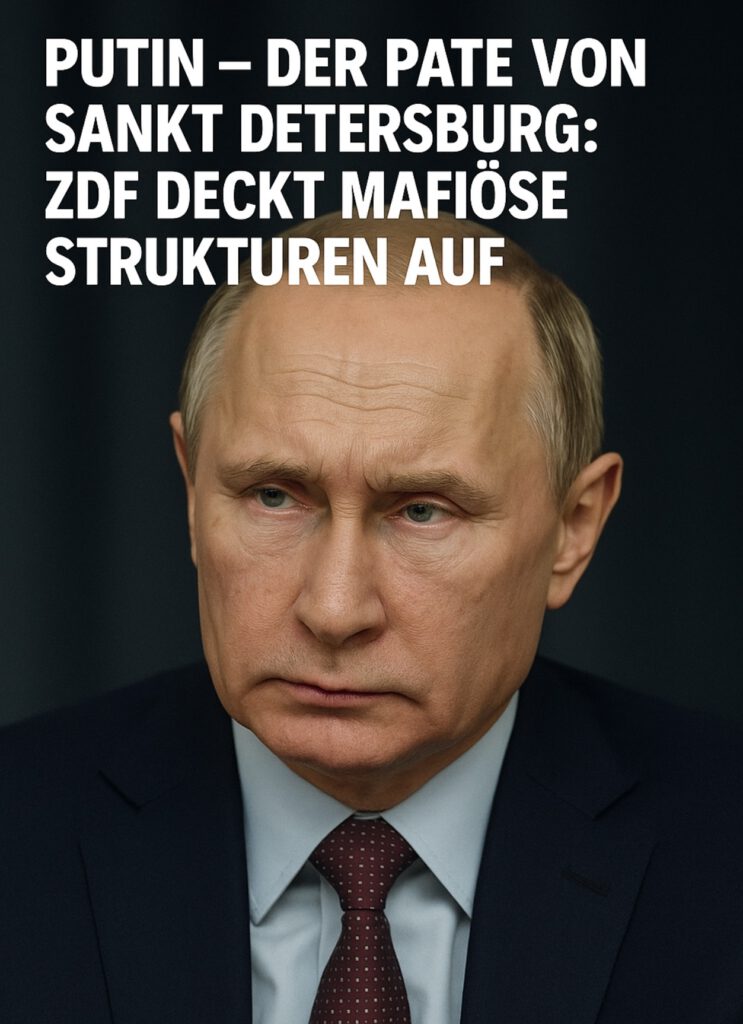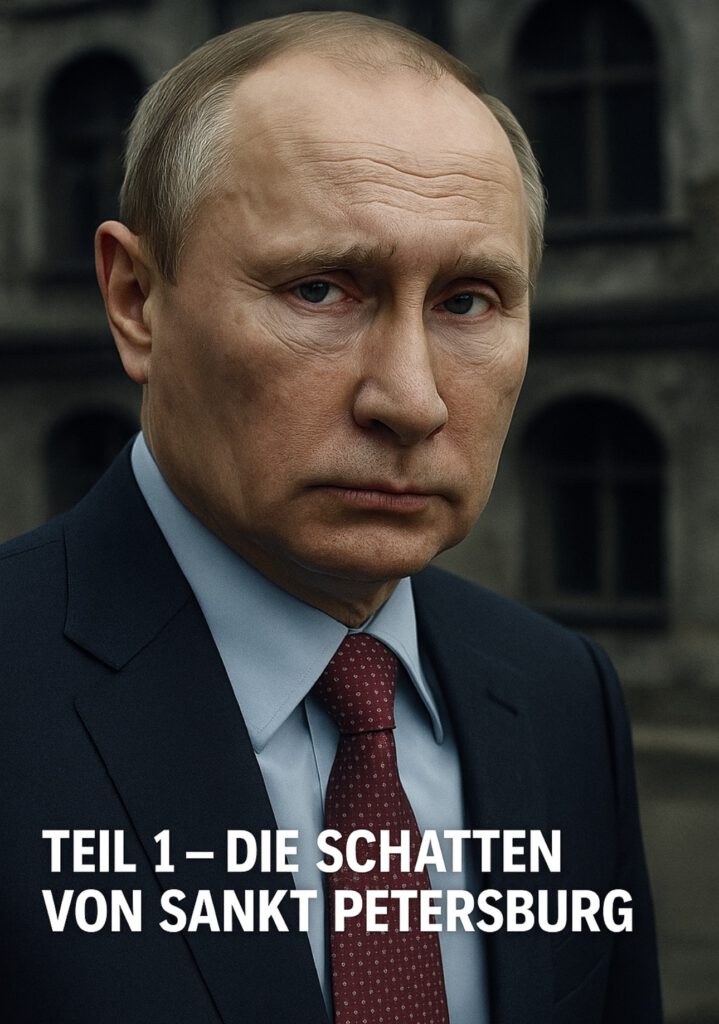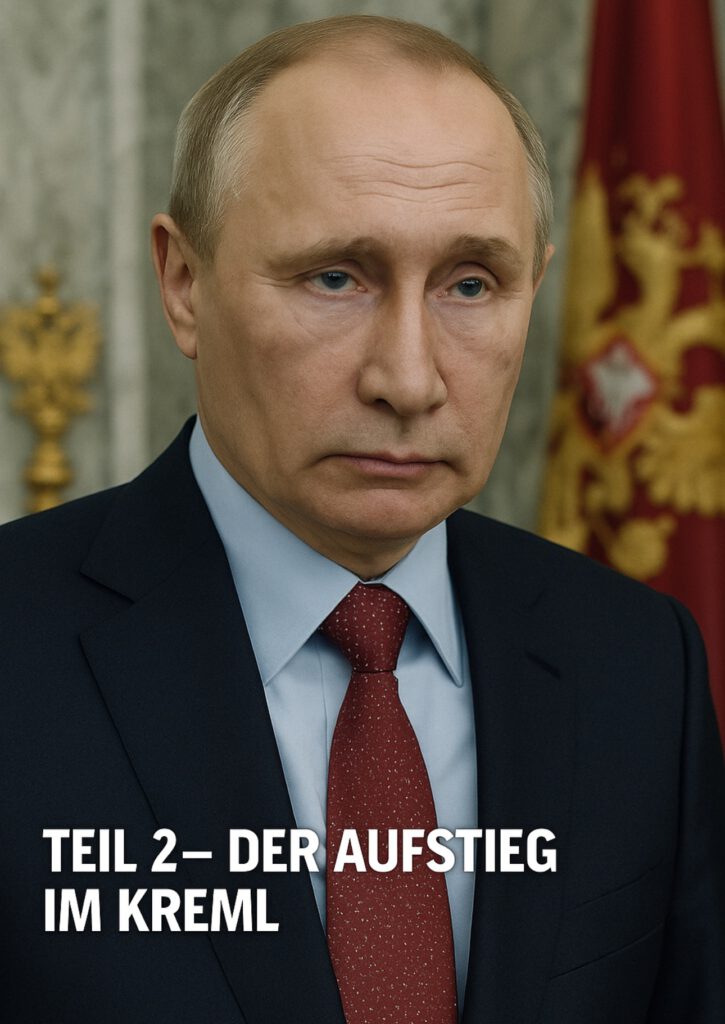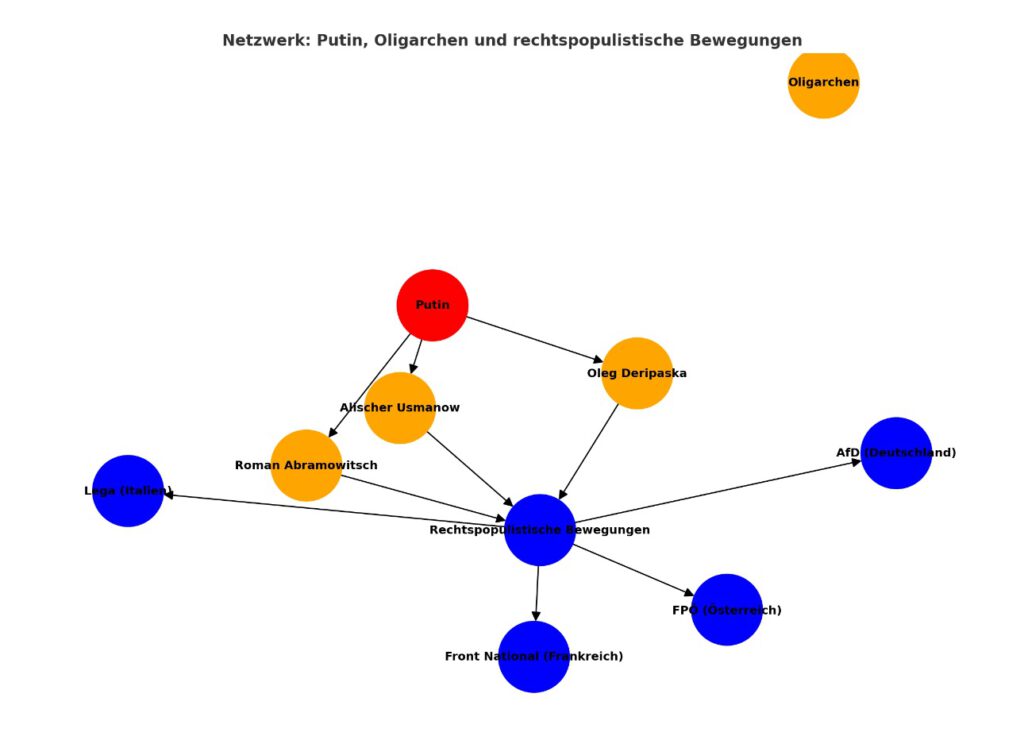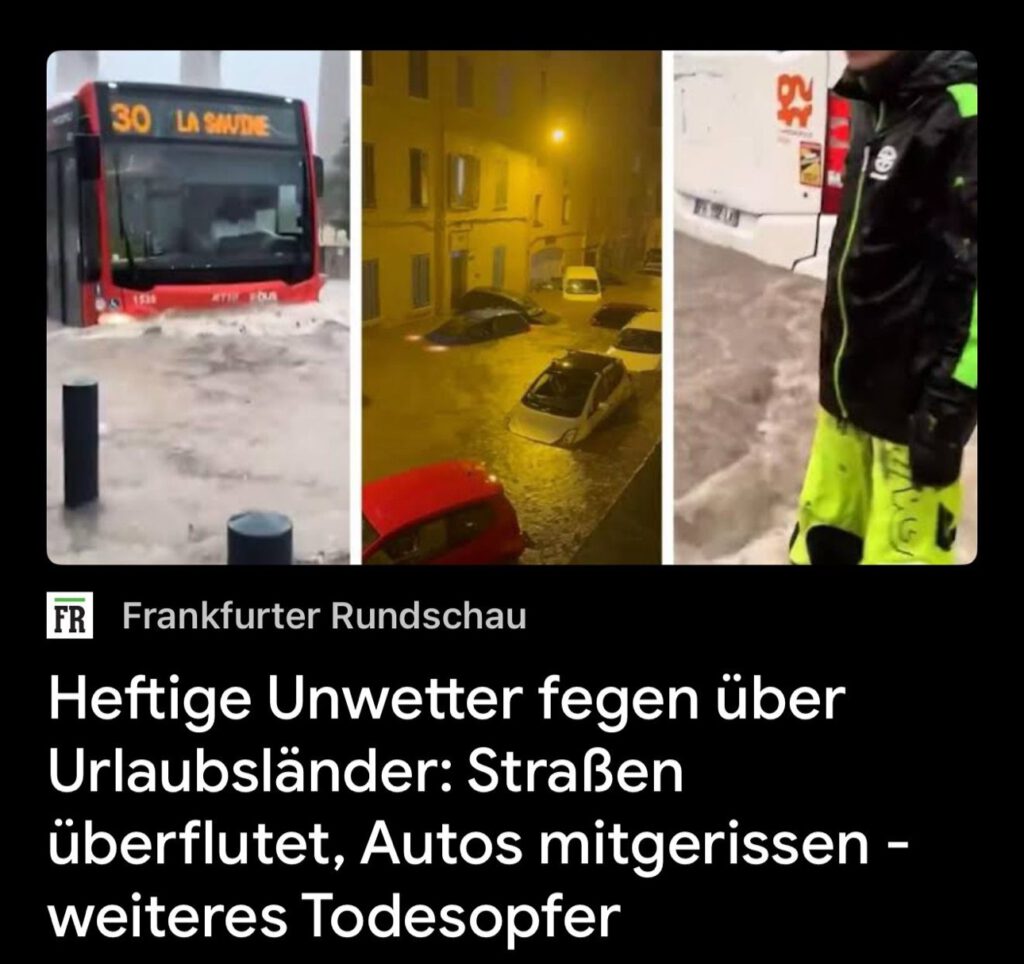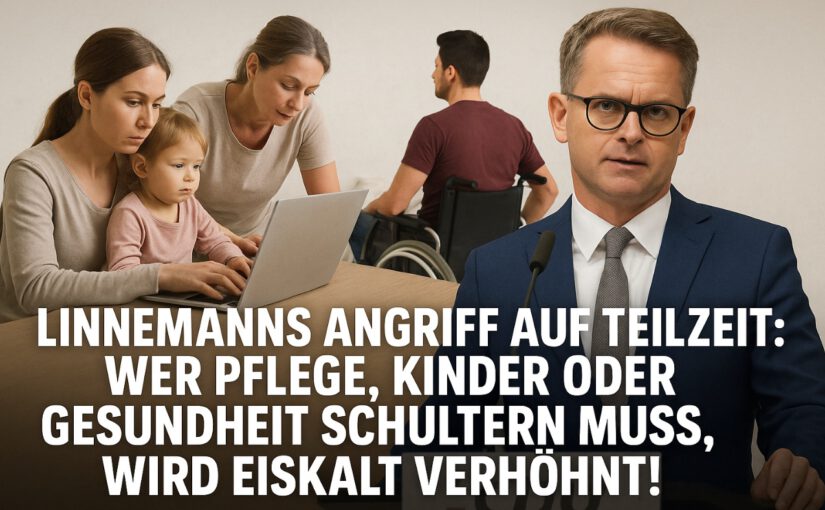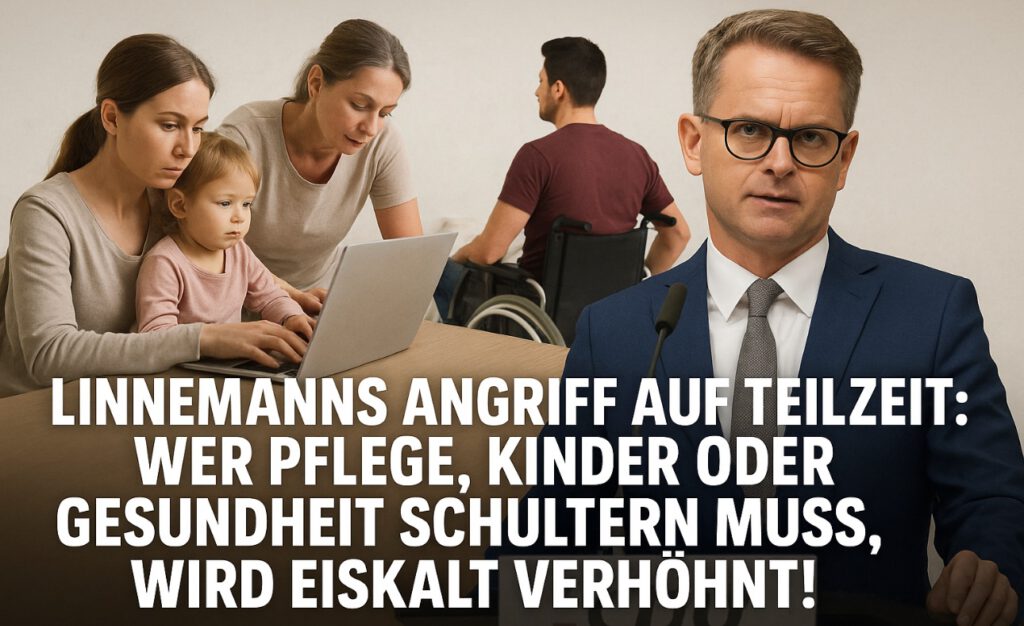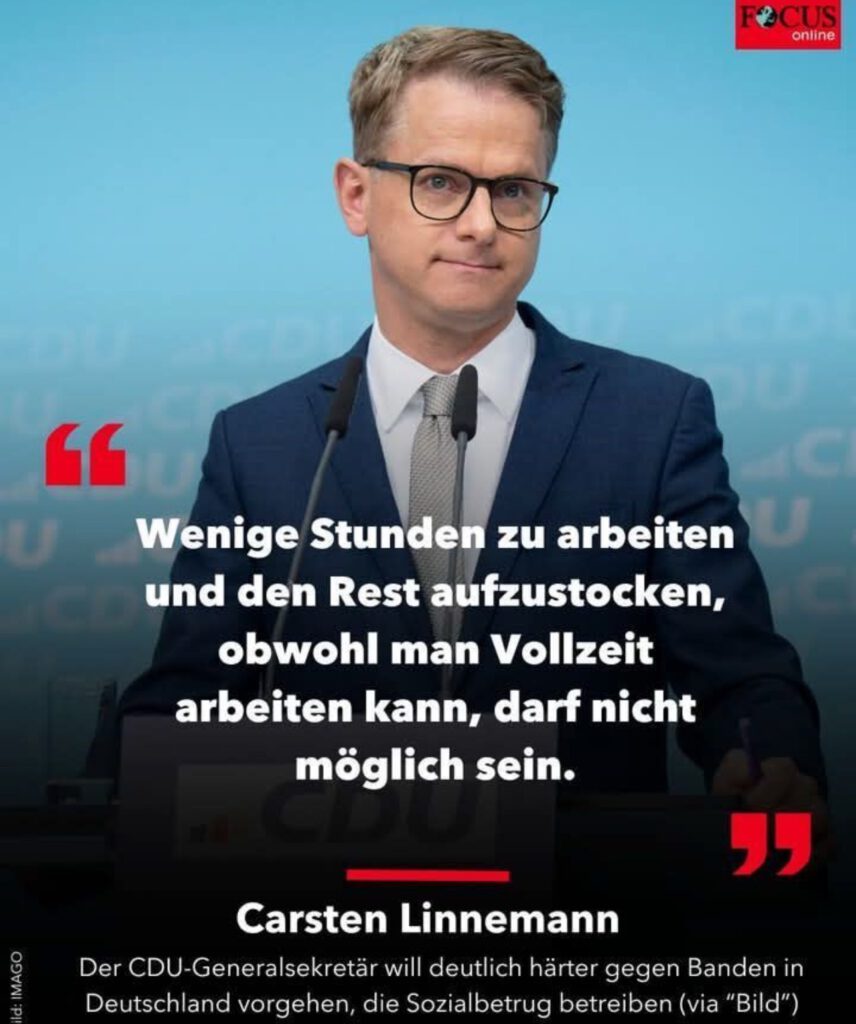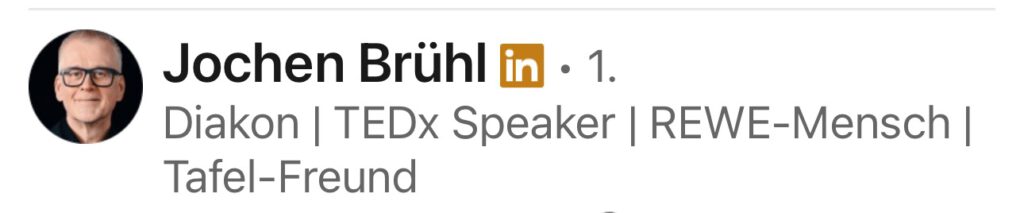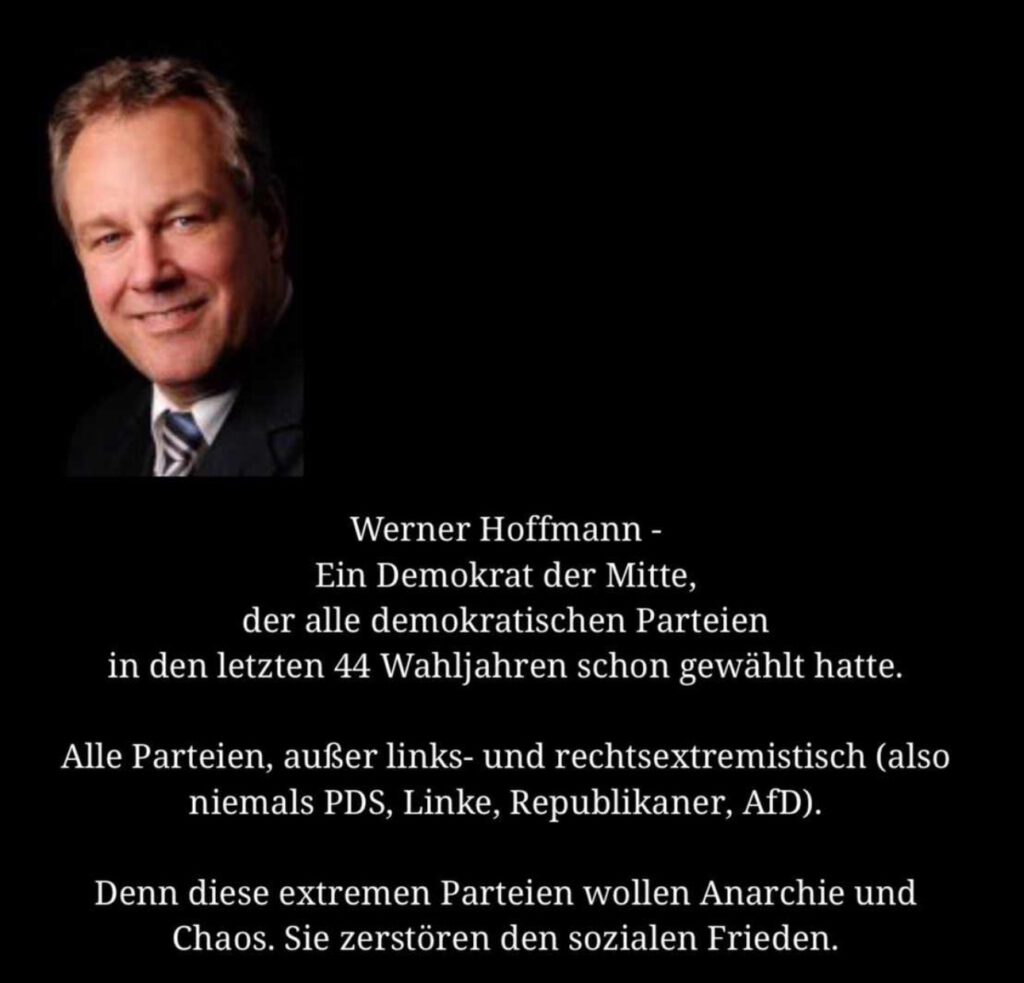Ein Beitrag von
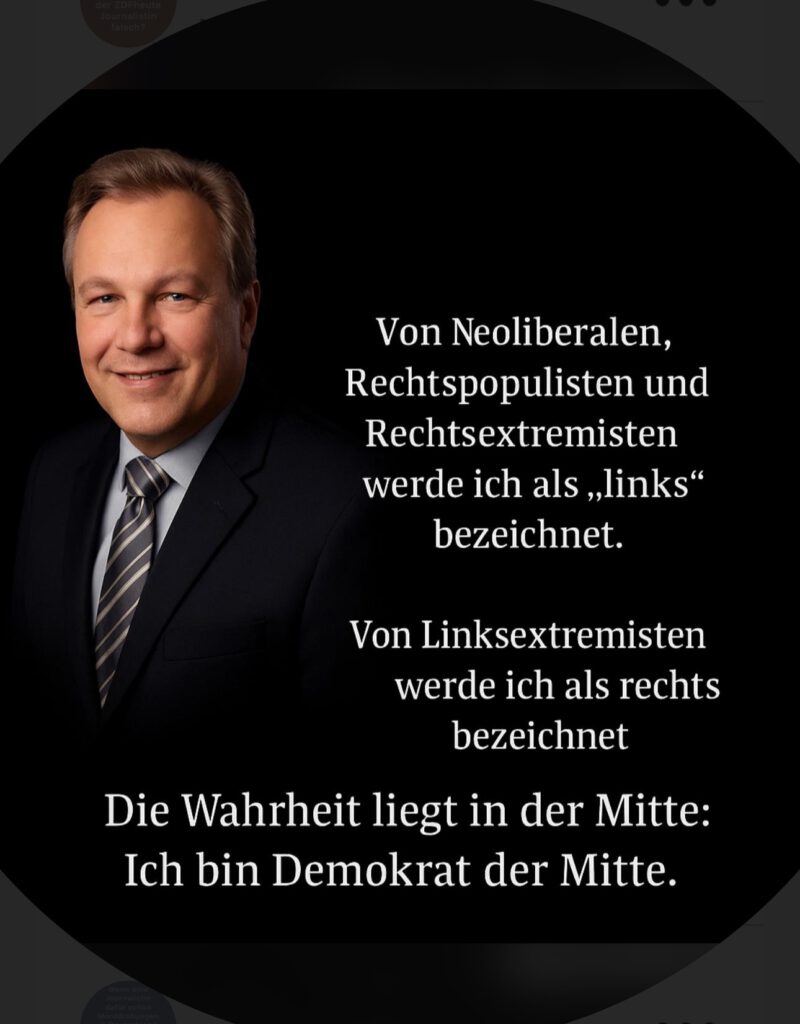
Werner Hoffmann
Auf der Internetseite www.blog-Demokratie.de gibt es viele interessante Artikel, die auch nach Fachbereich als Bereichsübersicht aufgerufen werden können.
Neben der regulären Suchseite gibt es auch eine kleine Faulenzertabelle, die ich Dir hier zur Verfügung stelle:
Fossile Lobby – Strategie
Hier findest Du Enthüllungen und Analysen darüber, wie Öl-, Gas- und Kohlelobbyisten Politik und Medien beeinflussen – mit besonderem Fokus auf Deutschland.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Fossile+Lobby+teil
Friedrich Merz
Von BlackRock bis fossile Interessen – wie der CDU-Chef seine Partei strategisch ausrichtet.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Merz
Jens Spahn
Von angeblicher Erneuerung bis gefährlichem AfD-Flirt – die Spuren von Spahn im Netz der Lobby.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Spahn
Carsten Linnemann
Angriffe auf Teilzeit, Sozialstaat und Energiewende – wie sich Linnemann als Scharfmacher positioniert.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Linnemann
Katherina Reiche
Die Ex-CDU-Staatssekretärin als fossile Strategin – von Lobbyverband BDEW bis ins Ministeramt.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Katherina+Reiche
CDU – Systematische und teilweise perfide Strategien
Die Union im Detail – wie Strategien, Netzwerke und Machtspiele organisiert werden, von Merz bis Linnemann.
—> www.blog-demokratie.de/?s=CDU
—> www.blog-demokratie.de/?s=CDU+Teil
CSU
Söder, Seehofer und die bayerische Fossil-Strategie – zwischen Tradition und Machtkalkül.
—> www.blog-demokratie.de/?s=CSU+Teil
Markus Söder:
—> www.blog-demokratie.de/?s=Söder
——
FDP
Die FDP als Bremser der Energiewende – von Christian Lindner bis Christian Dürr.
—> www.blog-demokratie.de/?s=FDP+Teil
—> www.blog-demokratie.de/?s=Dürr+FDP
AfD – Gefahr für die Demokratie
Die perfiden Spiele der AfD, ihre Netzwerke und ihre Nähe zu Russland – alle Teile gesammelt.
—> www.blog-demokratie.de/?s=AfD+Teil
Erneuerbare Energie
Alles zur Energiewende – Photovoltaik, Windkraft, Speicherlösungen und politische Blockaden.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Erneuerbare+Energie
Klima
Fakten und Hintergründe zur Klimakrise, ihren Folgen und den Leugnungsstrategien.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Klima+
Photovoltaik
Die Kraft der Sonne – Chancen, Technik und politische Widerstände.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Photovoltaik
Wärmepumpen
Moderne Heiztechnik als Schlüssel zur Klimaneutralität – und warum sie so stark bekämpft wird.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Wärmepumpe
Elektrofahrzeug
E-Mobilität zwischen Innovation, Lobby-Kritik und Zukunftsperspektive.
—> www.blog-demokratie.de/?s=Elektro
—-
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
HVO wird gern als „grüne Alternative“ verkauft – in Wahrheit oft ein Ablenkungsmanöver, das fossile Abhängigkeiten verlängert.
—> www.blog-demokratie.de/?s=HVO
eFuel
Synthetische Kraftstoffe klingen nach Zukunft, sind aber teuer, ineffizient – und dienen der Lobby, den Verbrenner künstlich zu verlängern.
—> www.blog-demokratie.de/?s=EFuel
Viel Freude bei der Anwendung und lasse Dich über so manche Inhalte überraschen
Die Ineffizienz von Verbrenner-nur knapp 5% vom dem Aufwand an Energie kommen auf der Straße an!
HVO-Artikelauswahl:
Artikelübersicht eFuel
Interessantes um den Verbrenner
#FossileLobby #CDUCSUFDP #AfDStoppen #Energiewende #Klimaschutz