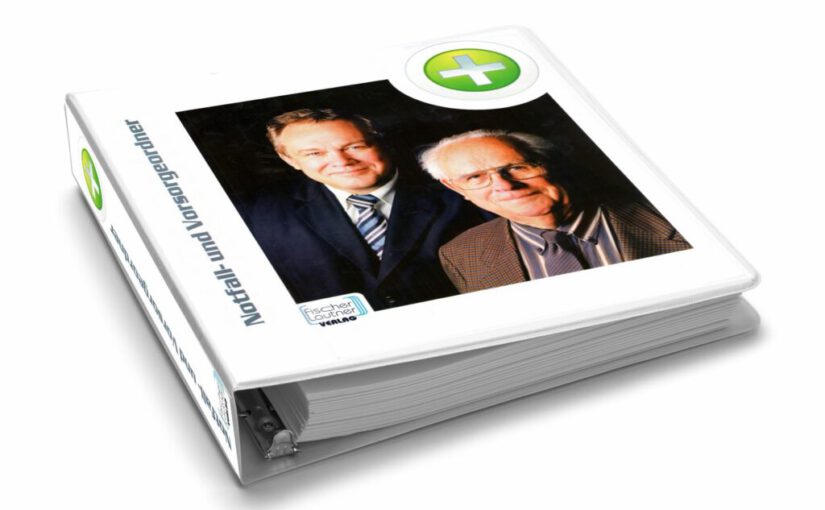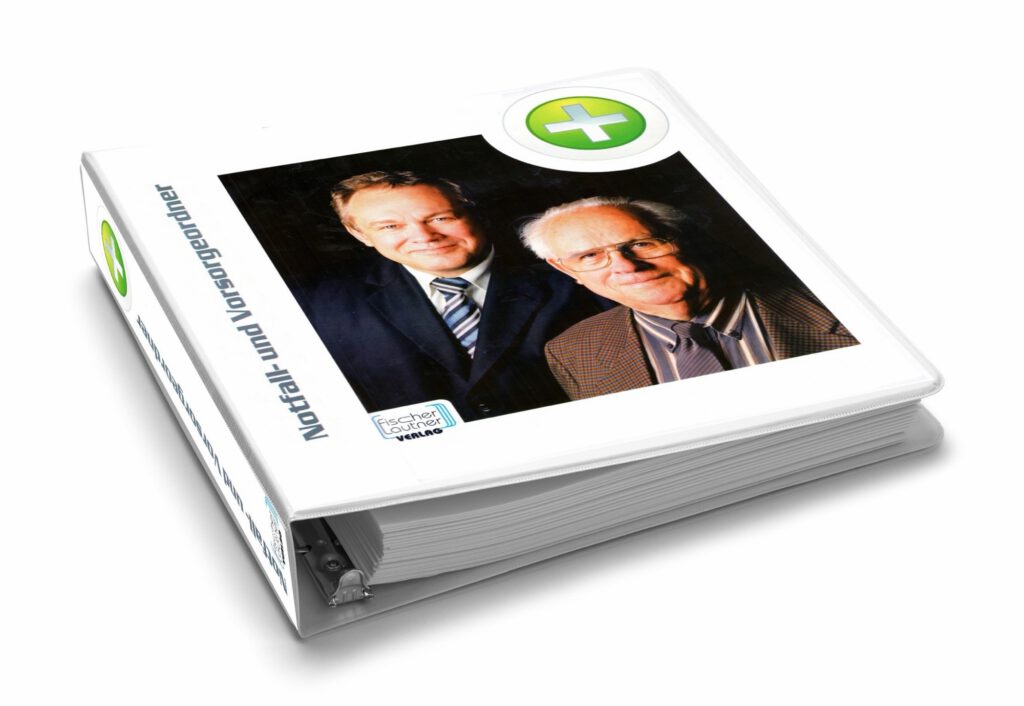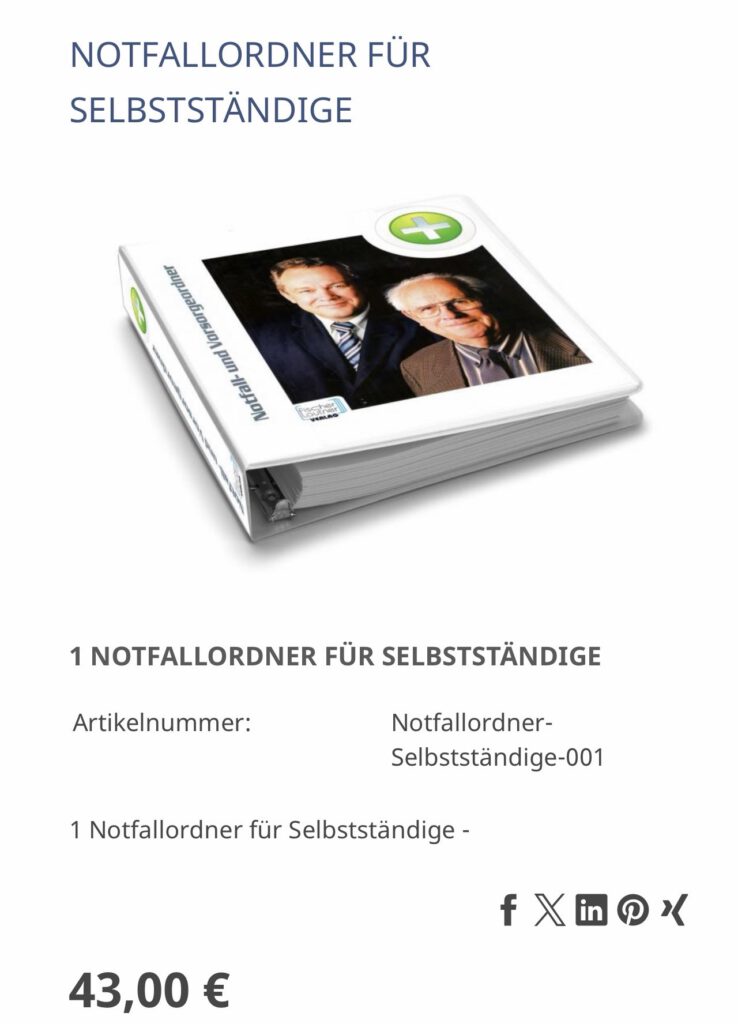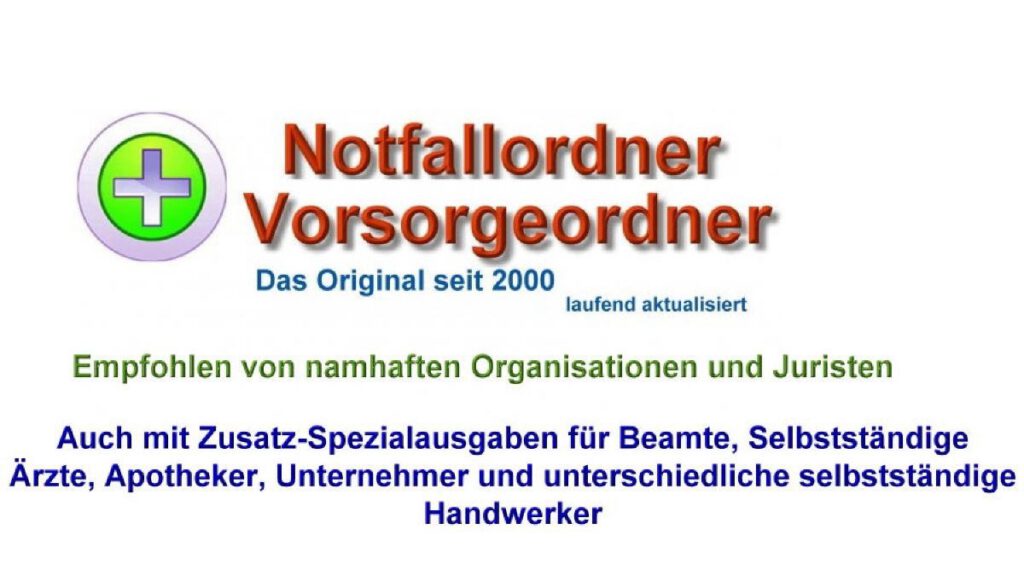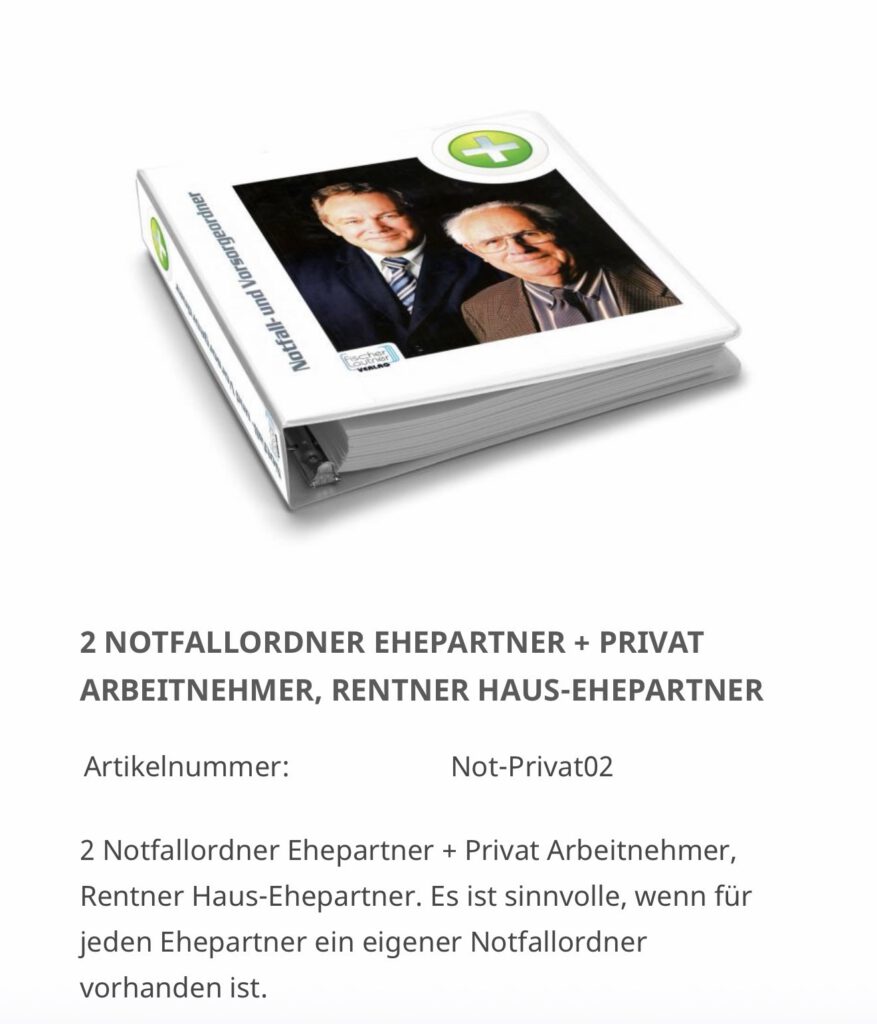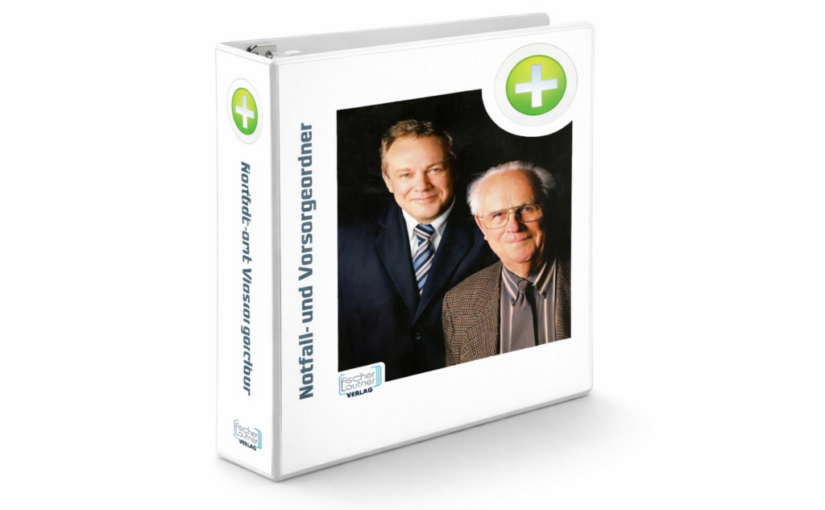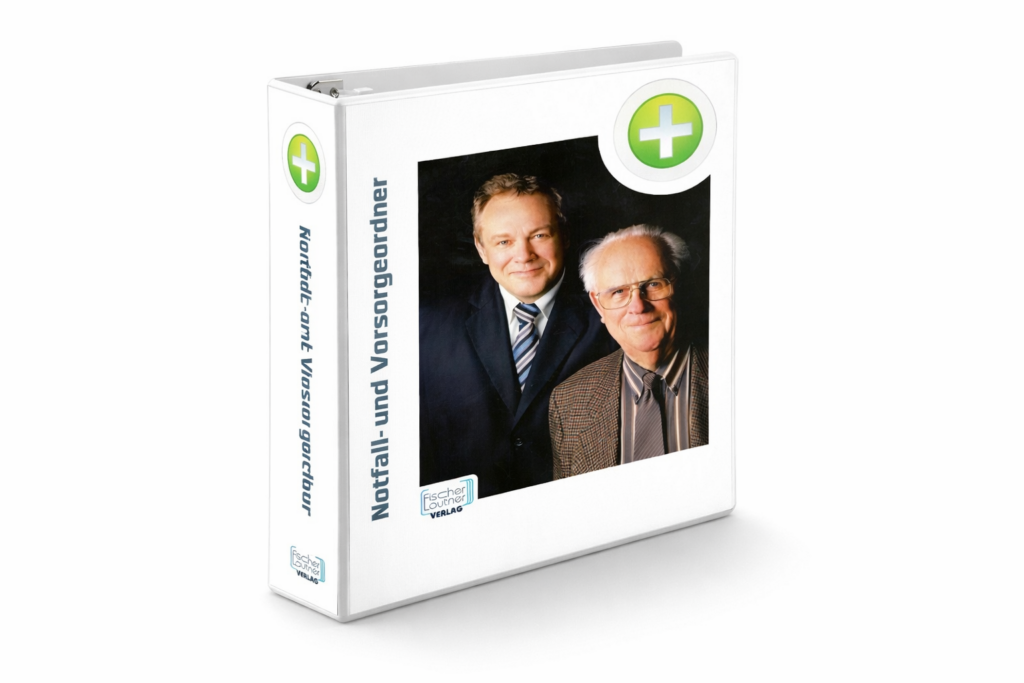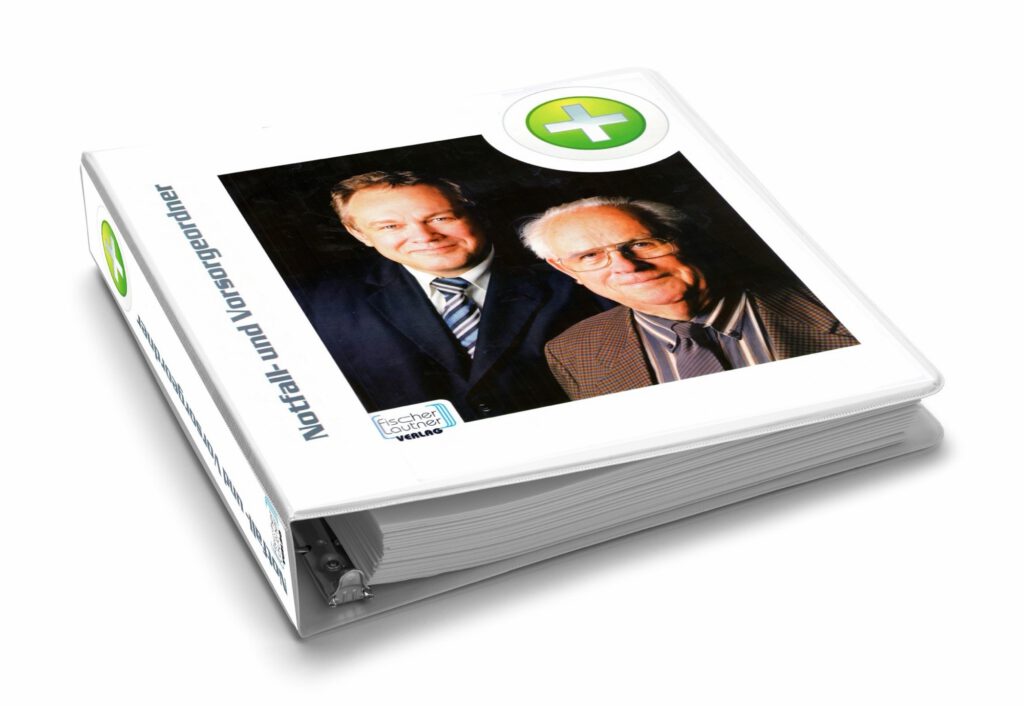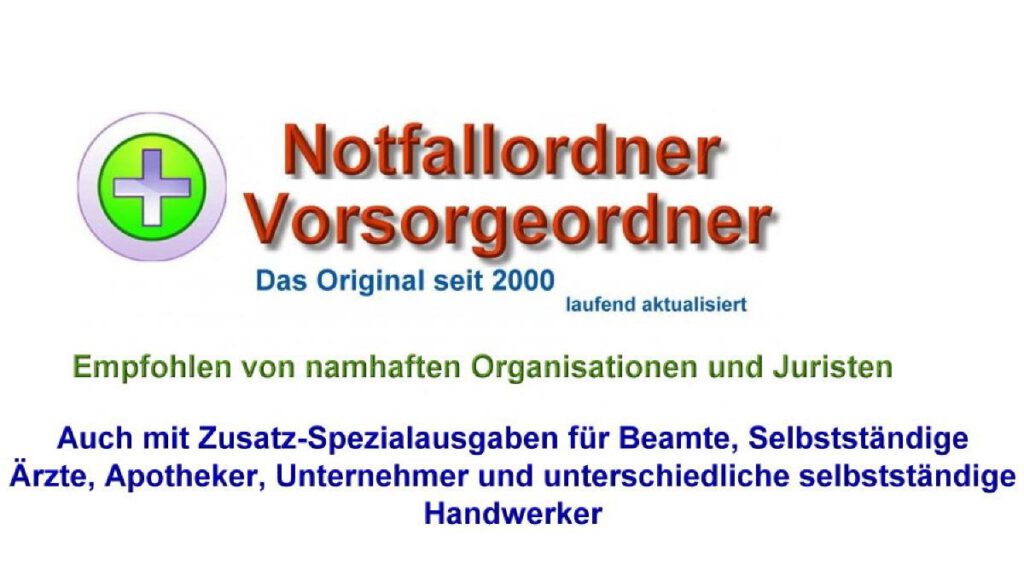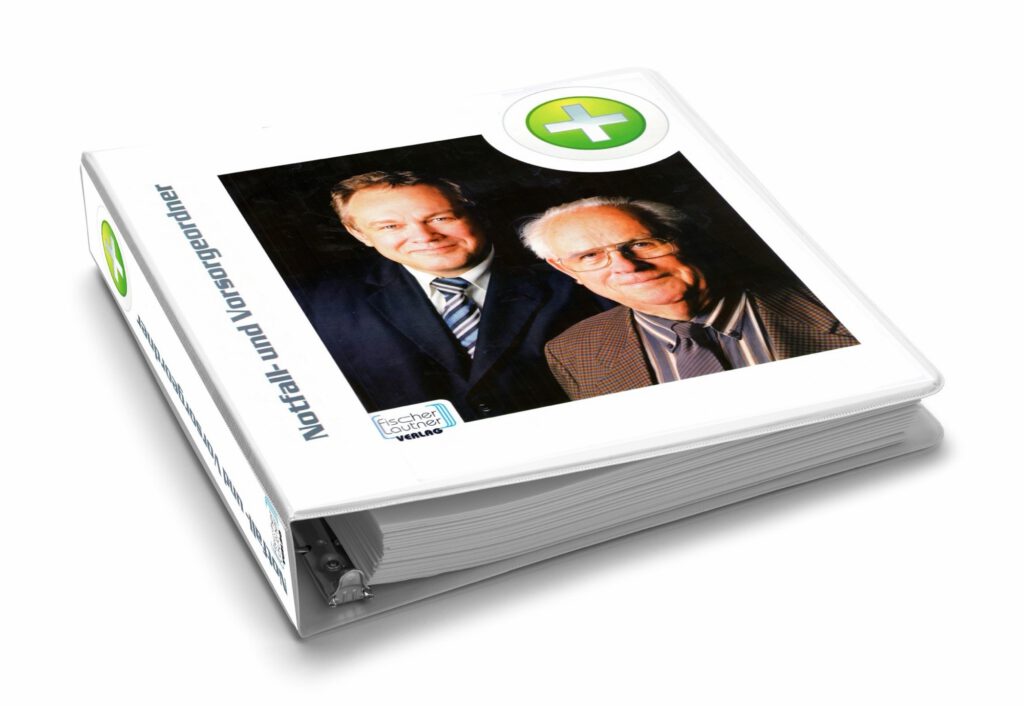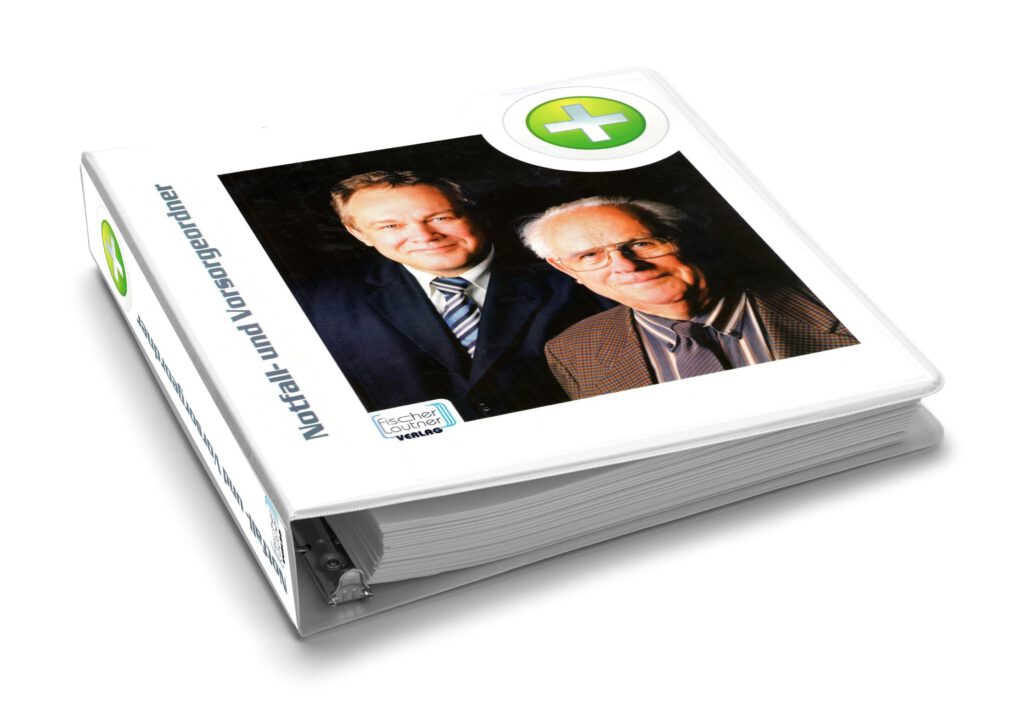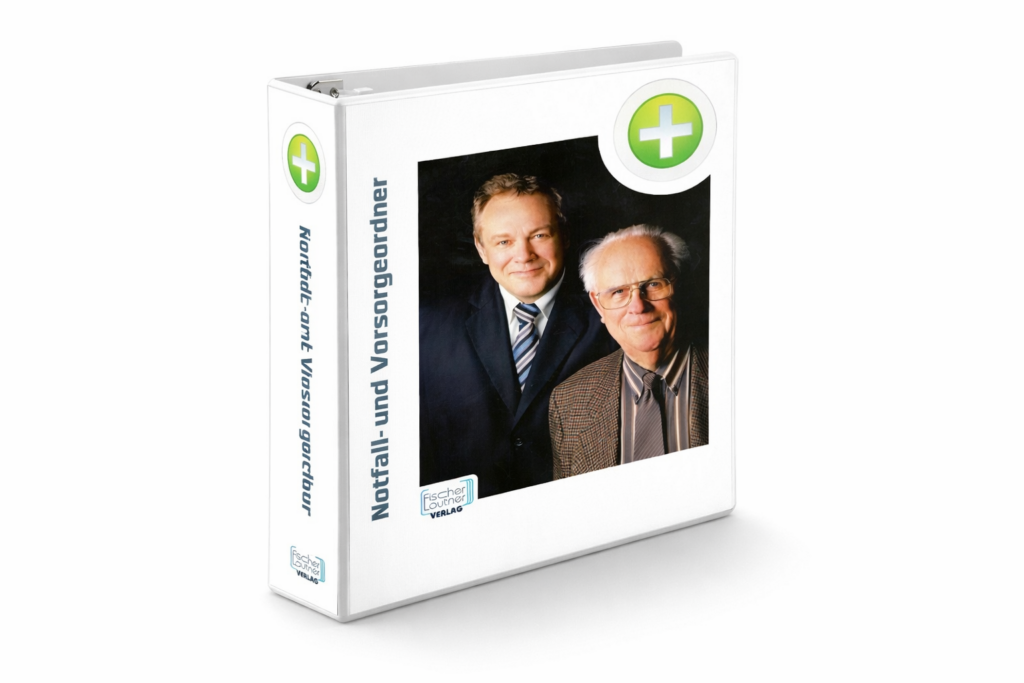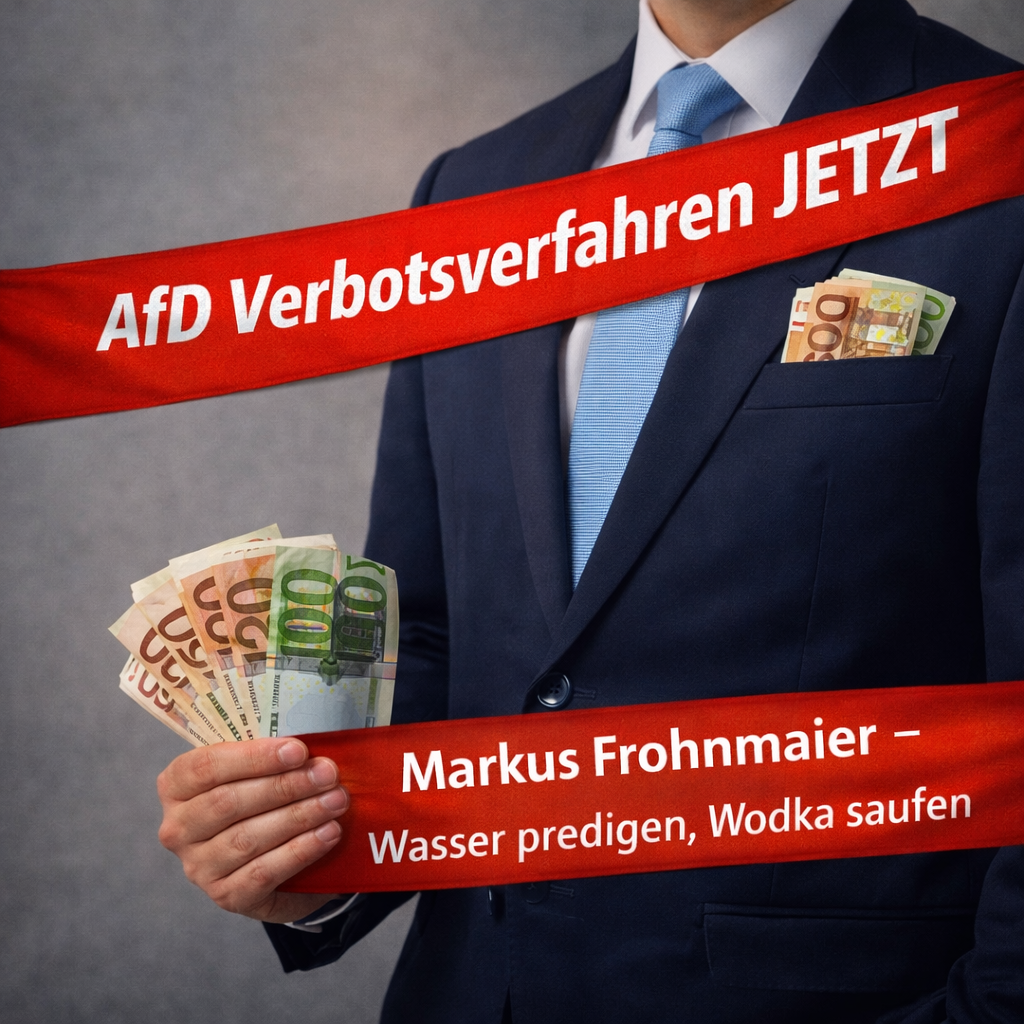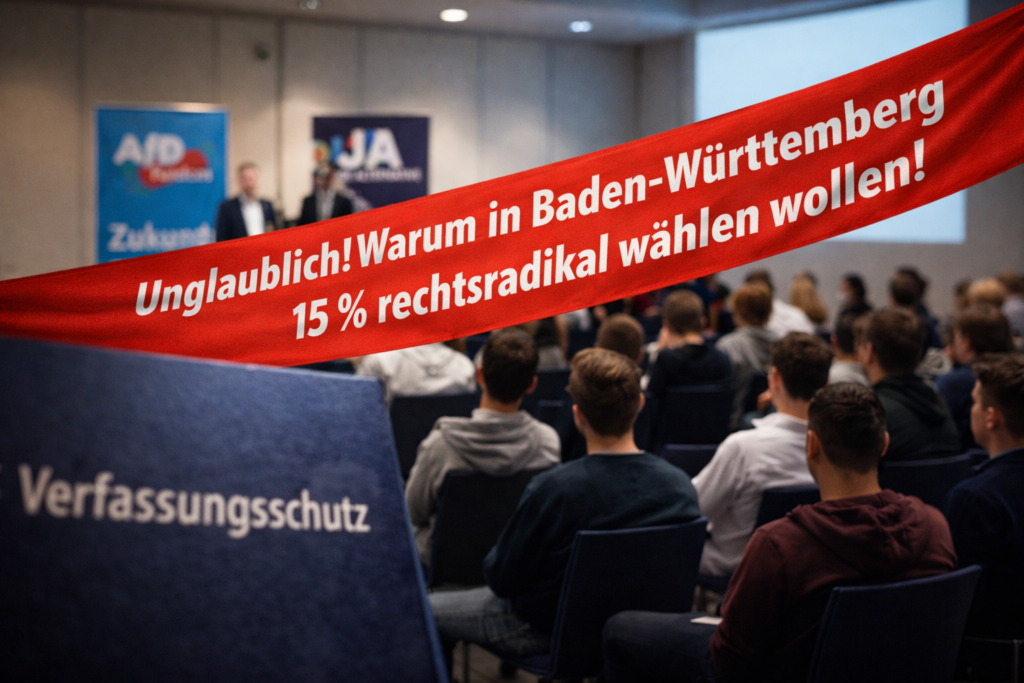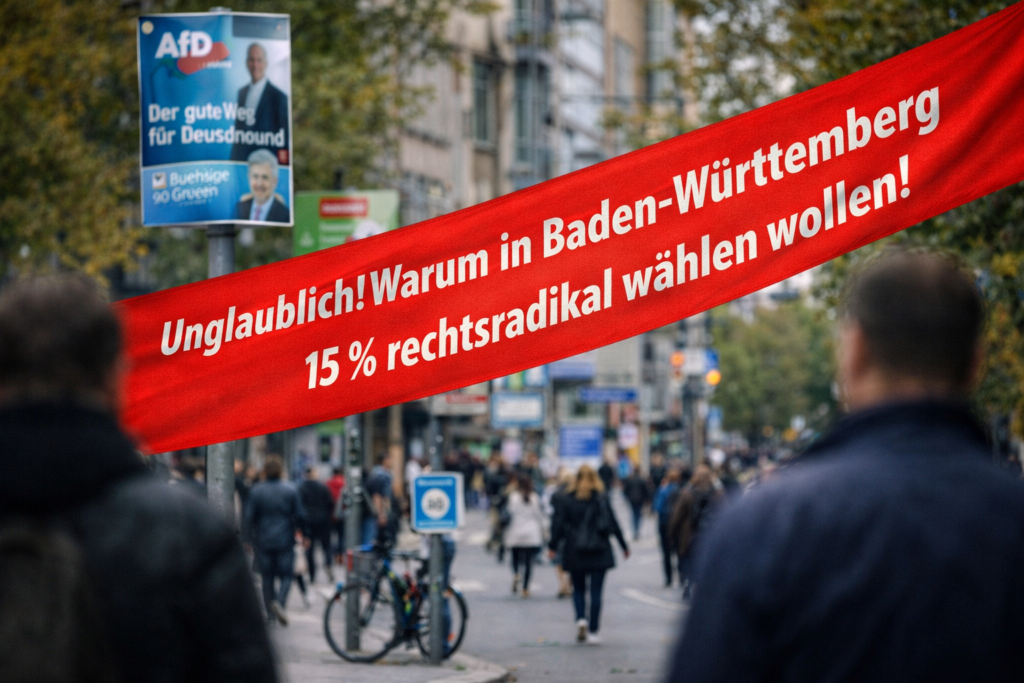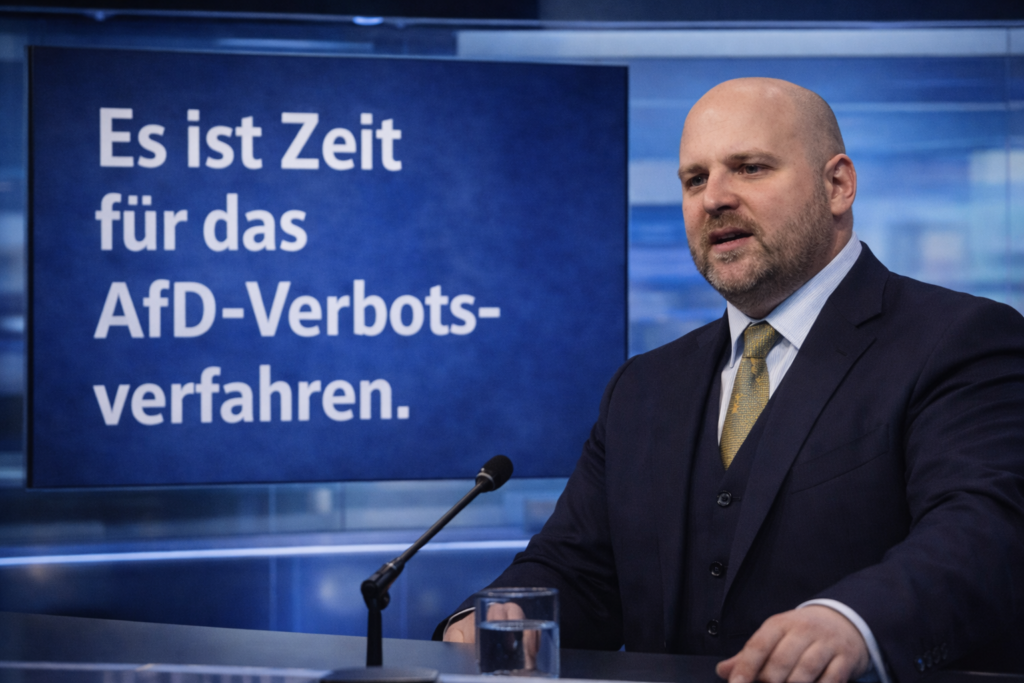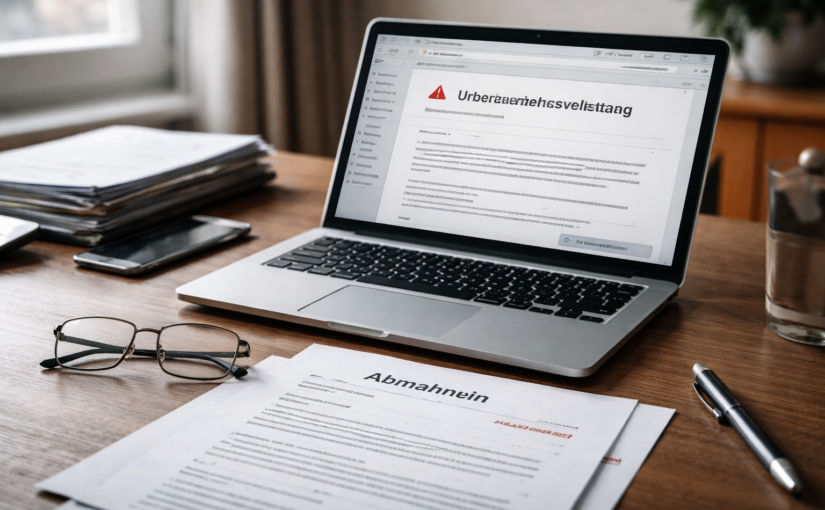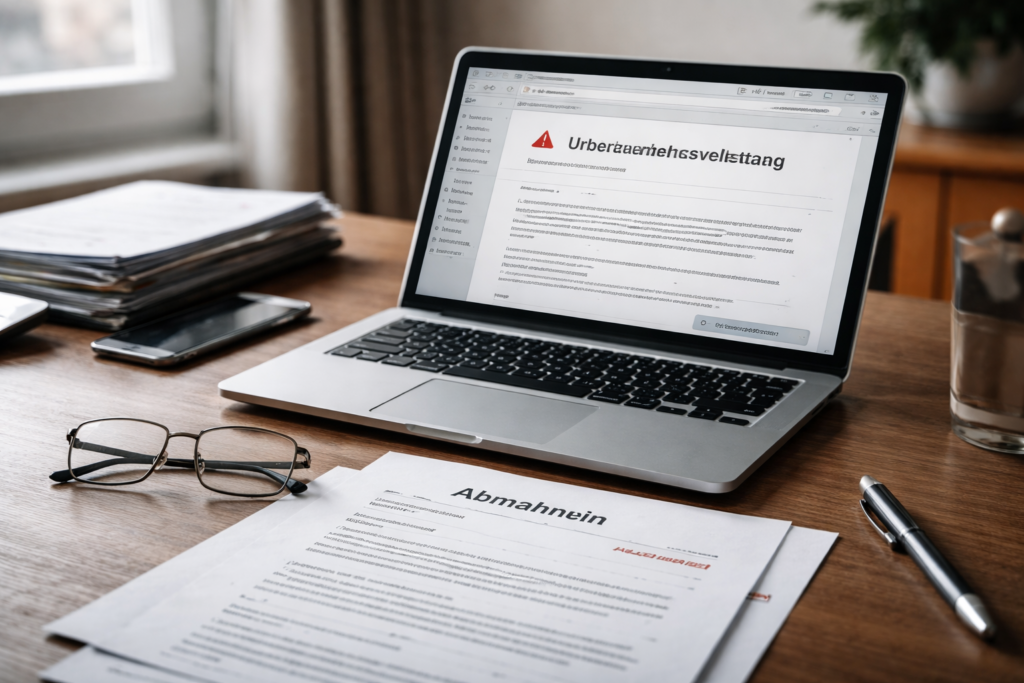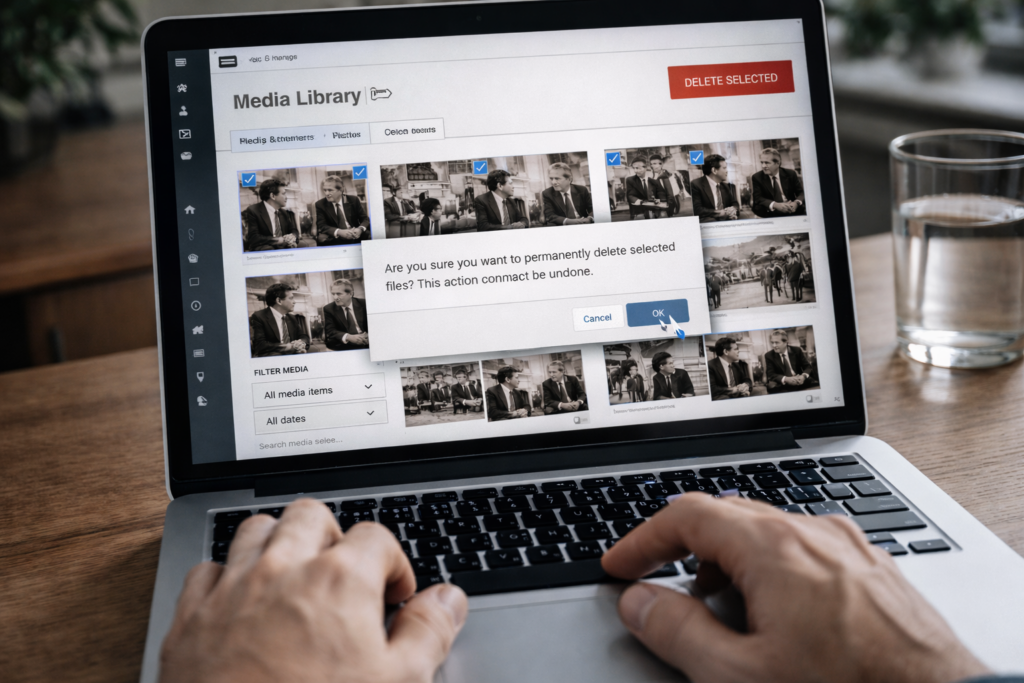Ein Beitrag von

Werner Hoffmann.
– www.Renten-Experte.de –
In einer Sendung von Markus Lanz ging es um die Frage, ob künftig auch Mieteinnahmen zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen werden sollten. Markus Lanz warf dabei sinngemäß ein, dass dann doch „der arme Rentner“, der seine Rente mit Mieteinnahmen aufbessert, ebenfalls Beiträge zahlen müsse.

Diese Darstellung ist problematisch – und spalterisch.
Denn sie suggeriert, Mieteinnahmen seien typischerweise ein Zeichen von Bedürftigkeit. Genau das ist faktisch falsch. Niemand fordert ernsthaft, kleine Vermieter oder Rentner mit moderaten Einnahmen zusätzlich zu belasten – ohne soziale Ausgestaltung.

Im Gegenteil: Es wäre ohne Weiteres denkbar, für Mieteinnahmen einen Freibetrag bei der Beitragsberechnung einzuführen. Beispielsweise könnten bis zu 15.000 Euro jährliche Mieteinkünfte beitragsfrei bleiben. Erst darüber hinausgehende Einkünfte würden berücksichtigt. Kleine Vermieter, Einliegerwohnungen oder eine moderate Rentenaufbesserung wären damit vollständig geschützt.
Lieber Markus Lanz, das war einmal wieder eine spalterische Aussage.
Die Realität des deutschen Mietmarktes sieht nämlich anders aus, als es Lanz’ Aussage nahelegt:
Rund 60 % der Mietwohnungen in Deutschland befinden sich im Besitz der obersten etwa 10 % der Bevölkerung.
Damit konzentriert sich ein Großteil des deutschen Mietwohnungsmarktes in den Händen einer vergleichsweise kleinen, einkommens- und vermögensstarken Gruppe – mit spürbaren Auswirkungen auf Mietpreise, Verhandlungsmacht und Wohnungszugang.

Quellen und Studien:
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin): Analysen zur Vermögens- und Immobilienverteilung in Deutschland, u. a. im DIW Wochenbericht zur Vermögenskonzentration,
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Dossiers zur Vermögensungleichheit und Eigentumsverteilung in Deutschland,
Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln): Studien zur Eigentümerstruktur von Wohnimmobilien und zur Konzentration von Mietwohnungen,
Statistisches Bundesamt (Destatis): Mikrozensus- und Vermögensstatistiken zur Wohn- und Eigentumsstruktur.
Lieber Markus Lanz: Ihr Spruch, dass arme Rentner durch die Mieteinnahmen aufbessern, ist etwas lustig und verdreht die Tatsachen.

Man könnte ja durchaus auch für Mieteinnahmen einen Freibetrag in der Kranken- und Pflegeversicherung bei der Beitragsberechnung einführen, so dass beispielsweise 15.000 Euro MietEINKÜNFTE nicht berücksichtigt werden.
#Krankenversicherung #Pflegeversicherung #Mieteinnahmen #SozialeGerechtigkeit #Vermögensverteilung