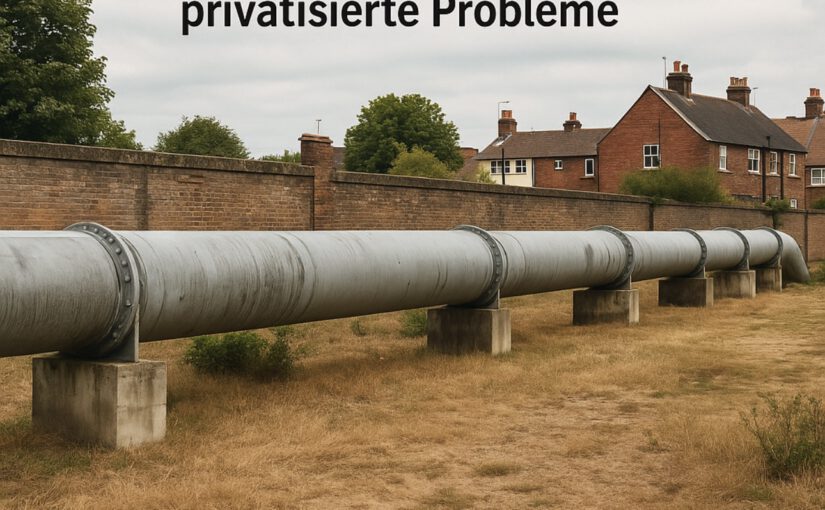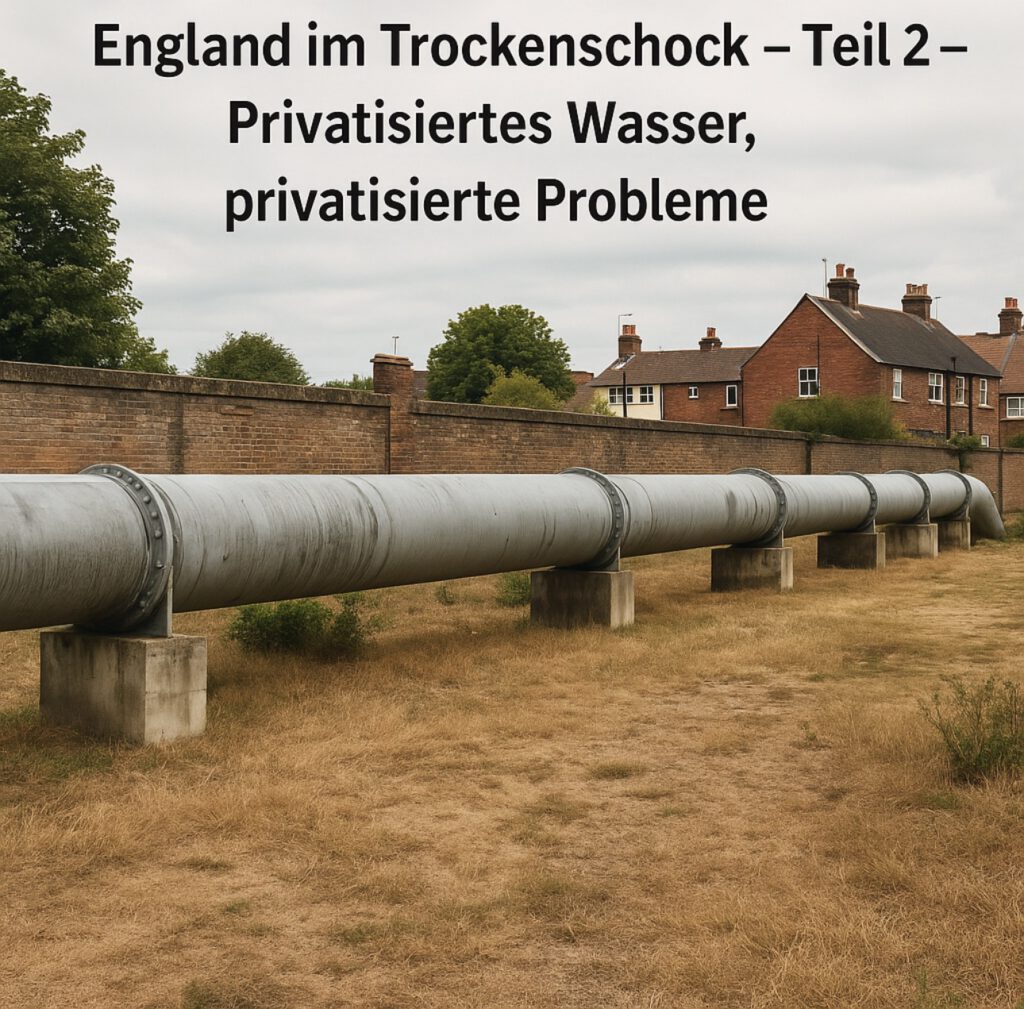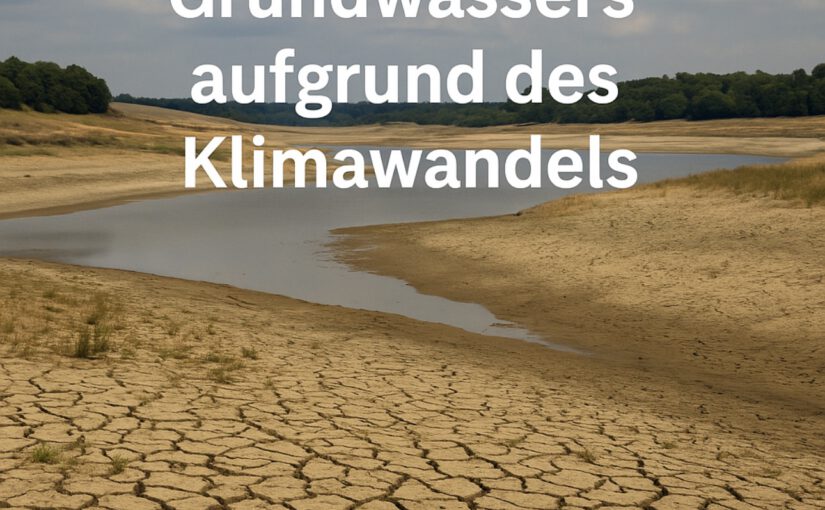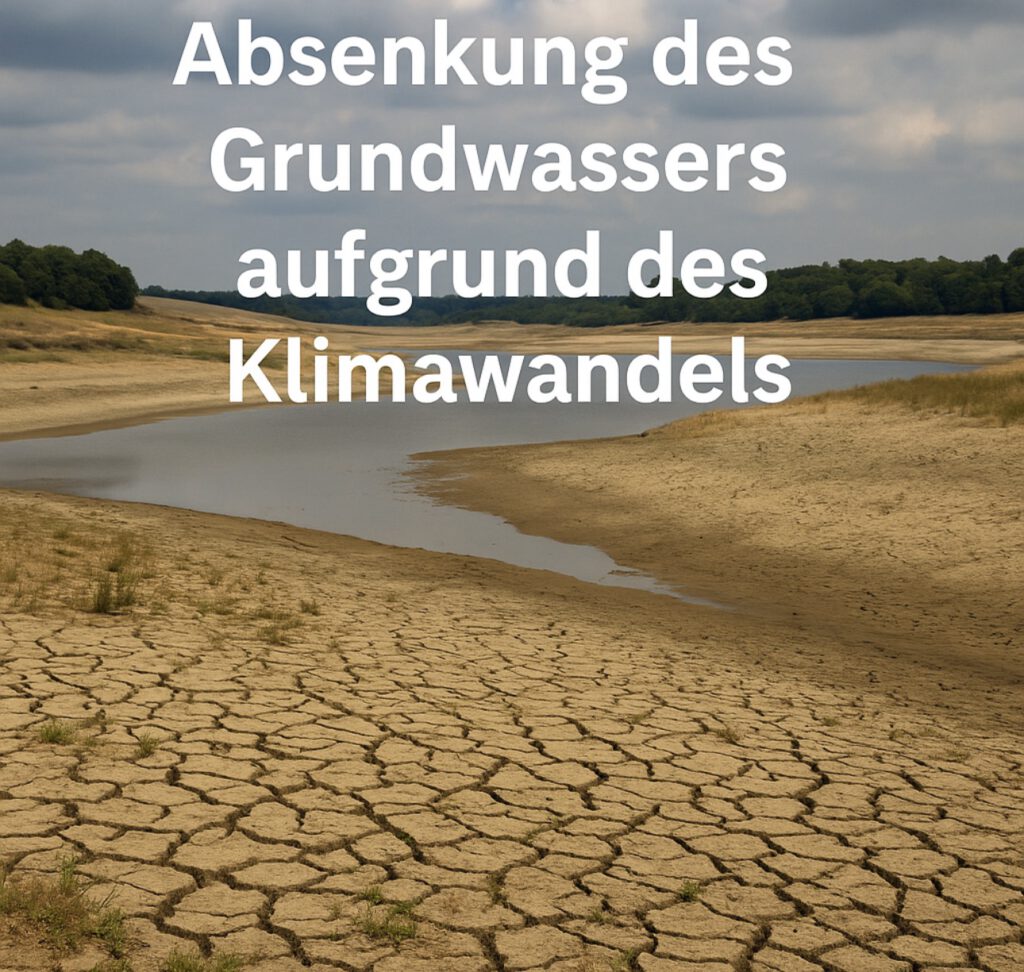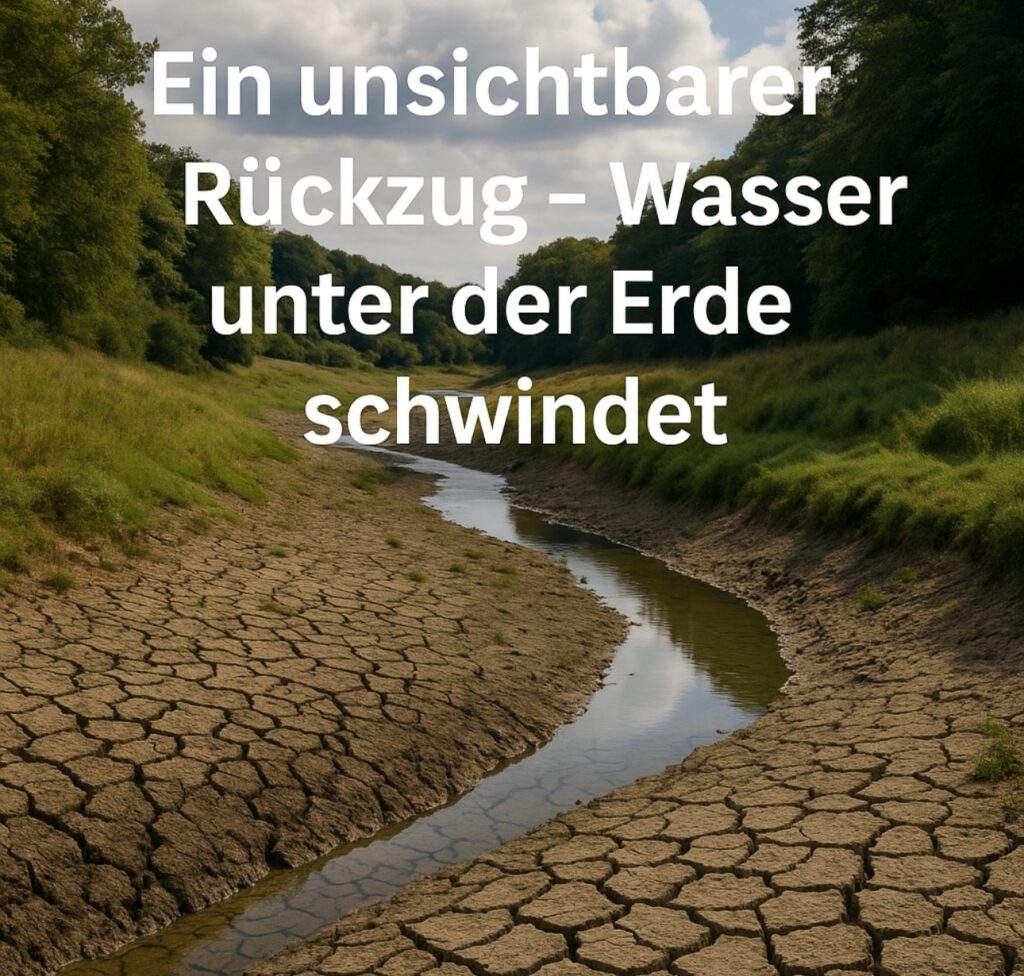Ein Beitrag von
Werner Hoffmann
Kernkraftwerke sind ohne verlässliche Kühlung nicht betreibbar.
In England verschärfen Dürreperioden, sinkende Grundwasserstände und steigende Wassertemperaturen die Risiken für die Atomstromproduktion – technisch, regulatorisch und ökonomisch.

Energiehunger trifft Wassermangel
Ohne Kühlwasser keine Kondensation des Dampfes und damit keine kontinuierliche Stromerzeugung. Hitze- und Dürrephasen führen zunehmend dazu, dass Meeres- und Flusswasser für die Kühlung nur eingeschränkt nutzbar ist.
Warum Kernkraftwerke so viel Wasser brauchen
- Im Reaktor erzeugte Wärme verdampft Wasser, der Dampf treibt Turbinen an,
- anschließend muss der Dampf im Kondensator wieder verflüssigt werden, wofür große Kühlwassermengen nötig sind,
- selbst bei Meerwasserkühlung benötigen Neben- und Notfallsysteme Süßwasser aus Flüssen, Reservoirs oder Grundwasser.
Wasserknappheit als unmittelbares Betriebsrisiko
- Leistungsreduktion: Überschreitet die Einlasstemperatur Grenzwerte oder würde der Rücklauf das Gewässer zu stark erwärmen, muss die Reaktorleistung gedrosselt werden,
- Lastabwurf/Abschaltung: Sinkt die verfügbare Kühlwassermenge unter Mindestwerte, ist ein geordneter Leistungsabwurf bis hin zur Abschaltung erforderlich,
- Kosten- und Preisspitzen: Fehlende Grundlast muss kurzfristig durch teurere Erzeugung (meist Gas) ersetzt werden – die Großhandelspreise steigen.
Fallbeispiel Hinkley Point C – Kalkulationen unter Klimadruck
Hinkley Point C wurde als verlässliche, preisstabile Grundlastquelle geplant. Die Klimarealität verschiebt die Annahmen:
- Höhere Meerestemperaturen verringern die Kühlreserve und erhöhen die Wahrscheinlichkeit temperaturbedingter Leistungsbegrenzungen,
- Algenblüten und Treibgut erfordern aufwendige Sieb- und Filtersysteme mit zusätzlichem Energie- und Wartungsaufwand,
- knapperes Süßwasser für Neben- und Notkreisläufe erzwingt Puffer- und Versorgungskonzepte, die die OPEX erhöhen.
Ergebnis: Produktionsprofile werden volatiler, Kapazitätsfaktoren können unter Plan liegen, der Strom aus Hinkley Point C wird faktisch teurer als ursprünglich kalkuliert.
Weitere Standorte: wiederkehrende Hitzestress-Effekte
- Sizewell B (Nordsee): Leistungsreduktionen bei warmen Sommern zur Einhaltung von Umweltauflagen,
- Heysham (Irische See): Algen- und Treibgutereignisse belasten die Kühlwasseraufnahme,
- Torness (Schottland): Hitzephasen führten bereits zu temporären Drosselungen.
Privatisiertes Wasser als zusätzlicher Engpass
In Dürrezeiten konkurrieren Kernkraftwerke um Süßwasser mit Haushalten, Landwirtschaft und Industrie. Rechtlich hat die Trinkwasserversorgung Vorrang – energetische Lastspitzen treffen dann auf reduzierte Kraftwerksleistung.
Was bedeutet das für die Energiewende?
- Kernkraft ist nicht wetterunabhängig – sie ist wasser- und temperaturabhängig,
- häufigere Hitzewellen und Dürreperioden erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Drosselungen,
- Systemkosten steigen, weil Reserve- und Flexibilitätsoptionen (Speicher, Demand Response, flexible Erzeuger) vorgehalten werden müssen.
Resümee
Die britische Atomstromproduktion steht im Klimazeitalter unter doppeltem Druck:
physikalisch durch heißeres, knapperes Kühlwasser
und institutionell durch einen privatisierten, verlustreichen Wassersektor.
Für Hinkley Point C bedeutet das: höheres Betriebsrisiko, potenziell niedrigere Volllaststunden, steigende Stückkosten.
Wer Atomstrom als stabile, günstige Grundlast verspricht, muss die Wasserrealität der kommenden Jahrzehnte in die Bilanz aufnehmen.
——
Teil 1:
Teil 2: